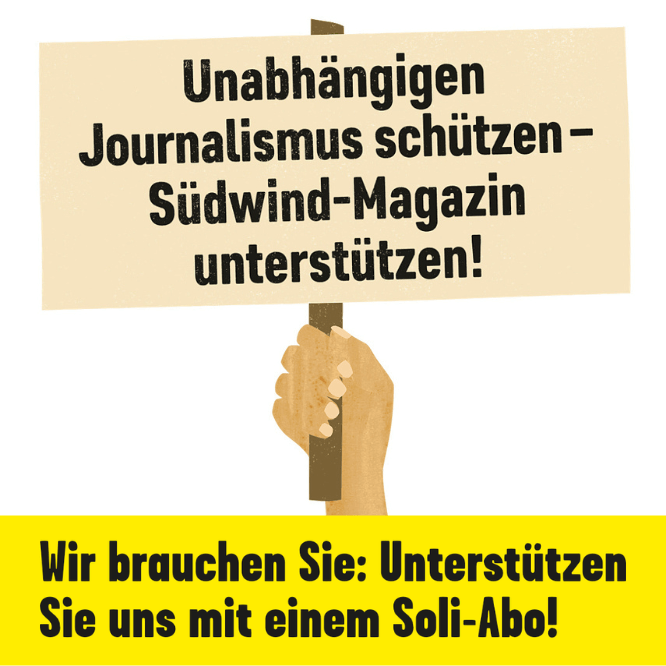Vor sieben Jahren versprach der damalige Chef der UN-Drogenbehörde, Pino Arlacchi, eine drogenfreie Welt in einem Jahrzehnt. Mehr als zwei Drittel dieser Zeit sind abgelaufen, doch der Rauschgiftmarkt wächst weiterhin. Die von den USA gepushte Zwangsvernichtung der Pflanzen erweist sich immer mehr als nicht zielführend.
Zweihundert Millionen Menschen, so schätzt das UNODC, konsumierten im letzten Jahr illegale Drogen. Über 300 Milliarden US-Dollar ist dieser Markt schwer – allein die US-Bevölkerung gibt jährlich zwischen 60 und 70 Mrd. für Drogen aus. Und etwa 50 Mrd. werden jährlich in den Drogen-„Krieg“ investiert. Nach sieben Jahren sieht es nicht so aus, als sei man dem erklärten Ziel wirklich näher gekommen: Die Bedrohung durch im Labor hergestellte Designer-Drogen wächst, und selbst gewisse Erfolge, die bei den klassischen, pflanzengestützten Drogen wie Kokain und Opiaten erzielt werden konnten, zerbröseln.
„Die Koka rächt sich“, sagt Bauer Eusebio und zeigt auf die jungen Pflänzchen, die überall im Wald stehen. Sie räche sich, meint er, für die Aktionen der Zwangsvernichtung von Kokafeldern, wie sie die bolivianische Regierung unter dem Druck der USA durchgeführt hat. Im Schutz des Militärs wurde die Anbaufläche in Bolivien zwischen 1998 und 2001 um mehr als 50% vermindert. Die Meldung Coca Zero (Koka null), mit der man sich vor vier Jahren brüstete, war zwar gemogelt, der Erfolg war aber trotzdem beachtlich. Der Preis dafür waren soziale Auseinandersetzungen, die Tote und Verletzte forderten und zur politischen Destabilisierung beitrugen, denn Koka ist für viele Familien der wichtigste Lebensunterhalt.
Rund 300.000 Familien leben in den Kokaanbaugebieten Boliviens. Allein der Wert der Kokablätter entspricht rund 3% des Bruttosozialprodukts und 17% der landwirtschaftlichen Produktion im Armenhaus Südamerikas – von der Weiterverarbeitung zur Kokainpaste und schließlich Kokain ganz zu schweigen. Die Preise für die Blätter, die bis 1998 bei 1,5 Dollar pro Kilo um die Rentabilitätsgrenze geschwankt hatten, liegen heute bei durchschnittlich 5 Dollar und stimulieren neuerlich den Anbau – im Hinterland: 71% der im letzten Jahr neu gepflanzten Koka steht in zwei angrenzenden Nationalparks.
Auch wenn die Kokapflanze für die Menschen in den Andenländern eine große spirituelle und magisch-mystische Bedeutung hat: Sie „rächt sich“ natürlich nicht. Von den Bauern werden Setzlinge gesteckt. Nun freilich kaum mehr in Form von Feldern, sondern sehr zerstreut: Hier eine Pflanze, dort eine – das macht eine Erfassung per Satellit immer schwieriger. Nach Zahlen der UNO hat sich der Kokaanbau in Bolivien gegenüber einem Tiefstand von 14.600 Hektar im Jahr 2000 bis heute nahezu wieder verdoppelt: Er liegt nun bei 27.700 Hektar.
Kolumbien ist für die UNO eine Erfolgsstory – noch: Der Kokaanbau habe dort seit dem Jahr 2000 halbiert werden können, so die Statistiken. Im letzten Jahr freilich nicht mehr ganz so stark. Auf jeden Fall ist Kolumbien hauptverantwortlich für einen Rückgang der Kokaproduktion im Andenraum um insgesamt 30%. Die Vereinten Nationen haben damit freilich wenig zu tun. Die Verantwortlichen für diese Politik sitzen im US-Außenministerium, von wo aus die massiven Besprühungsaktionen gelenkt werden. Dennoch sehen die dortigen ExpertInnen die Entwicklung wieder düsterer: Der Anbau in Kolumbien sei gegenüber 2003 im vergangenen Jahr bei 86.000 Hektar konstant geblieben – trotz einer Rekordbesprühung mit Pflanzengift von 136.555 Hektar. Das äußerst umstrittene US-Sprühprogramm, mit dem zwischen den Jahren 2000 (163.000 Hektar Anbaufläche) und 2004 (80.000) eine Halbierung des kolumbianischen Kokaanbaus erreicht wurde, trägt sehr klar die Züge der Aufstandsbekämpfung.
Die meisten Operationen fanden und finden in den südlichen Departements Putumayo und Caquetá statt, wo 61.600 respektive 20.000 Hektar vernichtet wurden – beides Hochburgen der linksgerichteten Guerilla FARC, die sich mit Erpressungen, Entführungen und Drogengeschäften finanziert. Unverhältnismäßig geringer sind einschlägige Anstrengungen im Norden, wohin sich der Anbau verlagert und wo die rechtsextremen Paramilitärs ihre Stützpunkte haben, die für die Mehrzahl der Menschenrechtsverbrechen verantwortlich gemacht werden und die mindestens ebenso in Drogengeschäfte verstrickt sind, mit denen die Regierung aber einen Friedensprozess eingeleitet hat.
Das UN-Drogenbekämpfungsbüro hingegen wirbt für die alternative Entwicklung. Damit sollen Lebensalternativen für die Betroffenen geschaffen werden, was nicht leicht ist: Koka wird zumeist in abgelegenen Zonen mit schlechter Infrastruktur angebaut. Für Alternativprodukte sind die Wege zu den Märkten oft weit, die Preise niedrig. Doch die Bauern sind häufig bereit, selbst Einkommenseinbußen in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür mehr Lebensqualität und -sicherheit bekommen. Beim herrschenden Druck der USA zur zwangsweisen Kokavernichtung ist der Rahmen für Alternativen jedoch sehr eng, die Mittel sind zu gering und man macht sich die Bauern von vornherein zu Gegnern statt zu Verbündeten. Im Eifer des Gefechts sind in der Vergangenheit in Kolumbien selbst Projekte der alternativen Entwicklung versehentlich besprüht worden.
Die Antwort Bogotás und Washingtons auf das enttäuschende Ergebnis des letzten Jahres kam prompt: Zusätzlich zu den bereits bewilligten 600 Mio. Dollar Anti-Drogen-Hilfe soll Kolumbien nun weitere 147 Mio. bekommen, für noch mehr Sprühflugzeuge und Kampfhubschrauber. Die Mittel für Projekte der alternativen Entwicklung in Kolumbien liegen demgegenüber für den Zeitraum zwischen 1999-2007 bei 590 Mio. Dollar, wovon USAID – die US-Entwicklungsagentur – 58%, die kolumbianische Regierung 38% und das UNODC den Rest beisteuern. Die internationale Gemeinschaft hält sich aus dem „schmutzigen Krieg“ heraus und überlässt das Feld denen, die auf militärische Lösungen setzen. Kolumbien hat im Rahmen des Plan Colombia (inzwischen Plan Patriota) von Washington seit Mitte 2000 bisher 4,5 Mrd. Dollar erhalten und ist damit der viertgrößte Empfänger von US-Militärhilfe. Mehr als die Hälfte dieser Mittel fließt an ein gutes Dutzend US-Söldnerfirmen, die im Rahmen der Drogen- und Aufstandsbekämpfung in Kolumbien tätig sind. Nicht berücksichtigt sind dabei jene Programme, die über das Pentagon abgewickelt werden, denn die unterliegen der Geheimhaltung.
Mangels Alternativen führt die zwangsweise Kokavernichtung dazu, dass die Bauern mit ihren Familien in die Armutsgürtel der Städte abwandern und dort das Reservoir der Hoffnungslosen und potenziellen Kriminellen vergrößern. Kolumbien durfte sich im letzten Jahr nach offiziellen Angaben über einen Rückgang der Kriminalität freuen: Es waren nur mehr 20.000 Morde und 1.440 Entführungen. Manche Bauern schließen sich einer der bewaffneten Konfliktparteien an: Der linksorientierten FARC mit 13.000 Kämpfern, der ELN mit 5.000 oder den rechtsextremen Paramilitärs mit ebenfalls über 10.000 Kämpfern. Und schließlich dringt ein Teil von ihnen tiefer ins Hinterland vor, um neue Wälder zu roden und wieder Koka anzubauen.
So in Bolivien: Seit dort im wichtigsten Anbaugebiet, dem Trópico de Cochabamba oder Chapare, im Juli 1984 Teile zur „roten Zone“ erklärt und von einer US-finanzierten Eingreiftruppe besetzt wurden, hat man insgesamt etwa viermal so viel Anbaufläche vernichtet als das jemals dort vorhandene Maximum: 36.000 Hektar Koka (1995). Ohne Nachhaltigkeit sind die jährlichen Vernichtungserfolge nicht nur ein drogenpolitischer Fehlschlag. Sie sind auch ein ökologisches und sozio-politisches Desaster: Rechnet man den üblichen Flächenverbrauch für Häuser, Wege sowie Anbau von Yucca und Trockenreis zur Eigenversorgung mit ein, so dürfte die Politik der Kokavernichtung im Trópico de Cochabamba zwischen 200.000 und 400.000 Hektar subtropischen Regenwald gekostet haben. Für die Weiterverarbeitung der an sich harmlosen Blätter zur Paste benötigt man große Mengen an Chemikalien. Eine Faustregel rechnet mit zwei Tonnen pro Hektar pro Jahr, darunter vor allem Kerosin als Lösungsmittel, aber auch Schwefelsäure. Die „Entsorgung“ über Gewässer und Erdreich stellt eine riesige Umweltvergiftung dar. Man kann dafür heute nicht mehr einfach einen Kokaboom verantwortlich machen, sondern in zunehmendem Maße eine verfehlte Politik, die die Nachhaltigkeit außer Acht lässt.
Peru, der vormals wichtigste Lieferant von Kokablättern, war nach einer Halbierung der Produktion Mitte der 1990er Jahre auf Platz zwei abgerutscht. Die USA schrieben diese Entwicklung ihrer Operation Airbridge zugute, mit der ab 1995 Drogentransporte unterbunden werden sollten. Verdächtige Maschinen wurden zur Landung gezwungen oder abgeschossen. Die Operation wurde unterbrochen, nachdem am 20. April 2001 versehentlich eine US-Missionarsfamilie über Peru abgeschossen worden war. Indes: Bereits 1998 waren die Kokapreise wieder scharf angestiegen. Nach der Zerschlagung der großen kolumbianischen Drogenringe von Medellín und Cali hatten in Kolumbien Dutzende kleinere Organisationen das Geschäft an sich gerissen, die nun nicht mehr im Ausland einkauften. Kolumbien stieg schnell zum größten Kokaproduzenten auf.
Robert Lessmann ist Journalist und Consultant; u.a. Autor der Bücher Drogenökonomie und internationale Politik (Frankfurt/M., 1996) sowie Zum Beispiel Kokain (Göttingen, 2001).
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.