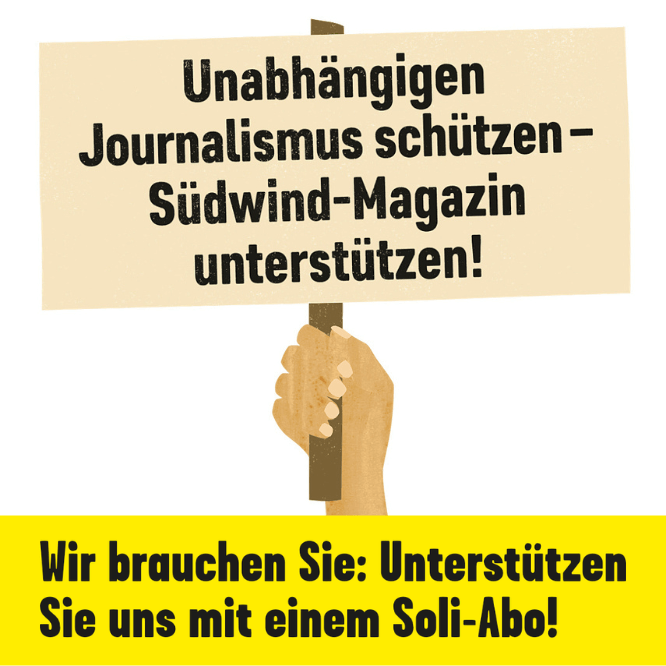Auch 100 Jahre nach ihrer Wiederentdeckung birgt die wichtigste Touristenattraktion Perus noch viele Geheimnisse.
Am vergangenen 7. Juli vor genau einem Jahrhundert wurde Machu Picchu, die sagenumwobene Inkastadt, offiziell wieder entdeckt. Die Festgala mit auserwähltem Publikum, darunter auch der scheidende Präsident Alan García, wurde mit einer fulminanten Lasershow über den Ruinen abgeschlossen.
Zur Amtsübergabe an seinen Nachfolger Ollanta Humala am 24. Juli erschien García jedoch nicht. Zu groß war seine Sorge, ausgebuht zu werden. Denn der scheidende Präsident hinterließ das 30-Millionen-Land voller Widersprüche: Die Wachstumsraten der Wirtschaft sind mit rund acht Prozent hoch, allerdings bei ungleicher Verteilung: 35% der Bevölkerung gelten als arm, 11,5% als extrem arm. Und während die etwa 15% überwiegend europäischstämmigen EinwandererInnen bisher in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik den Ton angaben, kommen die Armen aus den Reihen der Mestizos (über 40%), der Afroperuaner (7 %) und der Indígenas (knapp über 30 %), die sich noch am ehesten als Nachkommen der Erbauer von Machu Picchu fühlen dürfen, in deren Glanz sich so viele gerne sonnen.
1538. In den fünf Jahren seit dem Einzug von Hernando Pizarros Männern in der Inkahauptstadt Cuzco hat die neue Ordnung ihr Gesicht überdeutlich gezeigt. Zum Ruhme Spaniens und der höheren Ehre Gottes wird geraubt, zerstört, getötet und bekehrt. Bei der Ankunft Pizarros dürften auf dem Gebiet des heutigen Peru etwa neun bis zwölf Millionen Menschen gelebt haben. Hundert Jahre später werden es noch 600.000 sein. Die indianischen Völker, geknechtet, getreten und ausgebeutet, fressen den Staub der Geschichte, während die Conquistadores beginnen, sich aus Gier gegenseitig umzubringen. Manco Inka, der erste Inkaherrscher nach der spanischen Eroberung, der Cuzco und Lima gleichzeitig belagert, bringt die Eroberer an den Rand des Abgrunds. Noch bis 1572 leisten die letzten Inka von ihrer „Fluchtburg“ Vilcabamba aus Widerstand, bevor Tupac Amaru gefangen genommen und auf dem Hauptplatz von Cuzco hingerichtet wird.
Auf der Suche nach dem sagenhaften Vilcabamba stieß der nordamerikanische Historiker Hiram Bingham im Jahr 1911 auf Machu Picchu. Der Bauer Melchor Arteaga führte ihn zu Ruinen und Terrassen, die von den Einheimischen noch genutzt wurden. Tatsächlich war Bingham auch auf das wirkliche Vilcabamba gestoßen, hatte es aber nicht erkannt. Es befindet sich 80 Kilometer westlich von Machu Picchu.
Heute weiß man, dass Machu Picchu in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut wurde, wahrscheinlich unter dem Inka Pachacutec. Zwangsarbeit ermöglichte die erstaunlichen Leistungen. Das Inkareich, auf das sich manche indigenistische Emanzipationsprojekte heute berufen, war keine Demokratie, sondern ein despotischer Wohlfahrtsstaat. Man weiß auch, dass Machu Picchu von seinen BewohnerInnen freiwillig verlassen wurde – schon vor der spanischen Eroberung. Vielleicht im Zuge des Bruderkrieges zwischen Huascar und Atahualpa um die Thronfolge, der Pizarros Söldnertruppe überhaupt erst den Weg ebnete. Merkwürdig auch, dass keiner der spanischen Chronisten später den Ort erwähnte. War seine Existenz geheim? Nur wenigen Eingeweihten bekannt?

Ein einheimischer Träger auf dem Inka Trail; im Hintergrund der 6.271 m hohe Salcantay.
Man weiß, dass die Himmelsgestirne eine herausragende Bedeutung in der Kosmovision der Inka hatten, die sich als Söhne der Sonne verstanden. Verschiedene Gebäude von Machu Picchu hatten eindeutig die Funktion astronomischer Observatorien, allen voran der so genannte Torreón. Doch nicht nur einen Sonnen-, auch einen Berg-Kult glaubt der US-Anthropologe Johan Reinhard nachweisen zu können – und eine Kontinuität dieser Glaubensvorstellungen bis in die Gegenwart. Reinhard promovierte 1974 in Wien in Völkerkunde und machte 1996 als Archäologe mit einem Sensationsfund Furore: Eine Inkaprinzessin, die vor 500 Jahren auf dem Gipfel des 6.300 Meter hohen Nevado Ampato den Berggöttern geopfert worden war. Lawinen, Erdrutsche und Unwetter bedrohen das Leben in den Anden; Wasser ermöglicht es erst. Berge spielen noch heute bei den Ritualen der Indios eine wichtige Rolle. Sie gelten als Sitz von Ahnengeistern. In der Region Cuzco sind es vor allem Ausangate (6.372 Meter) und Salcantay (6.271 Meter), die als so mächtig angesehen werden, dass nur die erfahrensten Priester sie in ihre Zeremonien einbeziehen dürfen. Berge kontrollieren aus ihrer Sicht das Wetter, die Fruchtbarkeit der Felder und der Herden, sie sind Herren der Wildtiere und der Bodenschätze.
Bereits im Jahr 1991 legte Reinhard ein Buch vor, in dem er die Lage von Machu Picchu aus solchen geographischen Konstellationen erklärt, einer „heiligen Geographie der Bergvölker“, wie er das nennt. Von den Gletschern des Ausangate entspringt der heilige Urubamba-Fluss, dessen Wasser für die Region lebenswichtig ist. Die Anlage von Machu Picchu wird vom markanten Horn des Huayna Picchu um 200 Meter überragt; zusammen werden sie vom Urubamba wie von einem Omega umflossen.
Ein Land im Wachstumsfieber
Peru ist vorwiegend ein Agrarland. Von den Exporten entfallen 60% auf Mineralien. Peru profitierte hier von schwankenden, aber insgesamt für die Bergbauländer günstigen Preisentwicklungen auf den Weltmärkten.
Ein seit zwölf Jahren andauerndes Wirtschaftswachstum ermöglichte für das Andenland einen Sprung in der Länderrangordnung des Human Development Index der Vereinten Nationen um 15 Plätze auf Rang 63. Peru liegt damit hinter Chile, Argentinien und Uruguay auf Platz vier in Lateinamerika. Mit gut zwei Millionen BesucherInnen erbrachte der Tourismus im Jahr 2009 2,2 Mrd US-Dollar. Wegen der 100-Jahr-Feierlichkeiten war heuer im Sommer der Ansturm in Machu Picchu besonders stark.
R.L.
Astronomische Beobachtungen waren für die Inkaherrscher von großer Bedeutung, um ihre Verbundenheit mit der Sonne zu dokumentieren. Durch genaues Wissen um die Himmelserscheinungen im jahreszeitlichen Zusammenhang und ihre meteorologische Bedeutung legten sie ihre Zeremonien fest. Eine Fülle von Indizien weist in Richtung einer zeremoniellen Funktion der Stadt. Doch in jüngster Zeit werden in der Umgebung immer mehr Siedlungen und Terrassenfelder im dichten Wald gefunden, die auf eine intensivere Nutzung hindeuten als bisher angenommen. War Machu Picchu ein Regionalzentrum mit wichtiger religiöser Funktion? Ein abschließendes Urteil über die geheimnisvollen Ruinen wird wahrscheinlich nie möglich sein. Wir kennen ja noch nicht einmal ihren Namen. „Machu Picchu“, hatte Melchor Arteaga zu Bingham gesagt und gen Himmel auf den Grat gedeutet: So heißt der Berg, der über der Ruinenstadt steht, die „große“ oder „männliche Spitze“.
Wie auch immer: Machu Picchu ist vor allem durch seine Lage einzigartig, ein steinernes Dokument für die Virtuosität seiner Erbauer im Umgang mit der Bergtopographie. Bis heute gibt es keine Straße dorthin. Schon der Zugang über den berühmten „Camino Inca“ ist eine Sehenswürdigkeit. Machu Picchu ist ein Synonym für die Harmonie zwischen (indigenem) Mensch und der Natur. Das UNESCO-Weltkulturerbe (seit 1983) übt eine magische Anziehungskraft aus: Nicht nur auf scheidende und angehende Präsidenten, sondern auch auf Esoteriker und Pauschalreisende aus aller Welt. Nur maximal 180 Wanderer pro Tag dürfen sich auf den vier Tage langen, klassischen „Inka Trail“ machen, um die fragile subtropische Bergökologie zu schonen. Die meisten der jährlich 300.000 BesucherInnen kommen aber mit dem Zug; Frühmorgens von Cuzco aus hin, abends zurück. Bis zum 600 Dollar teuren Ticket im Restaurantzug „Hiram Bingham“ reicht das Angebot, doch für die einheimischen Bäuerinnen und Bauern gibt es seit der Privatisierung der Bahn kaum mehr erschwingliche Verbindungen. Die Strecke hinunter nach Urubamba, wo das amazonische Tiefland beginnt, wurde nach einem Erdrutsch überhaupt stillgelegt. In Aguas Calientes, dem Endpunkt der Bahn unterhalb der Ruinen, herrscht architektonischer Wildwuchs. Die örtliche Tourismuskammer von Cuzco klagt über ein Missverhältnis zwischen BesucherInnen- und Nächtigungszahlen. Machu Picchu sehen und weiterreisen! Allzu oft – und sehr zu Unrecht – stehen die Sehenswürdigkeiten in und um die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches im Schatten des berühmten Außenpostens.
Robert Lessmann, freier Mitarbeiter des Südwind-Magazins, kennt die Andenregion Südamerikas von zahlreichen Reisen und längeren Aufenthalten.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.