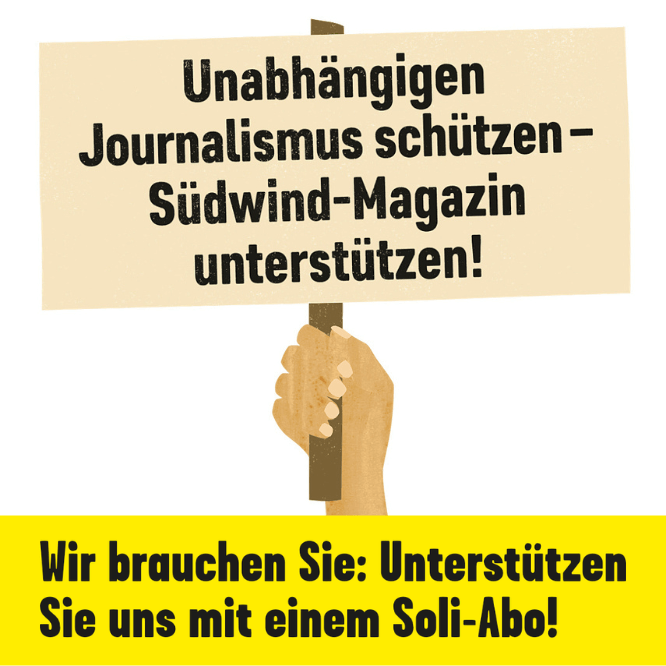In der Klemme
Ohne substanzielle Martktöffnung im Norden droht selbst bisher erfolgreichen Entwicklungsländern ein fataler verdrängungswettbewerb.
Genau so verhält es sich auch – großteils. Traditionell dachte man dabei aber bloß an Rohstoffe. Entwicklungsländer, so hieß es, könnten diesem Verfall ihrer „Terms of Trade“ entkommen, wenn sie statt Rohstoffen Industrieprodukte exportierten. Setzt man die Latte bei einem Industrieproduktanteil von 50 Prozent an, gelang das zwischen 1968-70 und 1998-2000 allerdings nur 27 von 111 Ländern, wie die Welthandelsorganisation WTO in ihrem letzten Bericht Anfang Mai konstatiert – und dabei sind sechs davon noch Ministaaten: Kapverden, Antigua und Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti und St. Kitts and Nevis.
Ernüchternd genug. Tatsächlich zeigen sich aber selbst bei den erfolgreichen Ländern „beunruhigende Trends“, wie es die UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) in ihrem „Trade and Development Report 2002“ formuliert.
Trend 1: „Arbeitsintensive Industriegüter, die von Entwicklungsländern exportiert werden, verhalten sich mehr wie Rohstoffe als wissens- bzw. technologieintensive Industrieprodukte“. Auch die Stars der Globalisierung in Asien, darunter China, müssen trotz High-Tech-Exporten einen Verfall ihrer Terms of Trade hinnehmen.
Trend 2: Zwar steigen die Industrieexporte der Entwicklungsländer insgesamt kräftig, doch wird relativ dazu immer weniger Einkommen im eigenen Land erwirtschaftet. Noch 1981 erreichte die Wertschöpfung der Industrie einen Anteil von 77 Prozent am Wert der Industrieexporte, 1996 waren es nur mehr 55 Prozent. In den reichen Ländern sanken die entsprechenden Anteile von 225 auf 180 Prozent, schätzt die UNCTAD.
Besonders krass wirkte sich der Aufbau der auf den US-Markt orientierten Maquiladora-Industrie in Mexiko aus: Der inländische Wertschöpfungsanteil sank zwischen 1986 und 1998 von rund 110 auf 28 Prozent. Ähnlich in China: Hier fiel der Anteil etwa im selben Zeitraum von 700 auf 100 Prozent. Bringt das unter dem Strich wenigstens Devisen? Auch das ist fraglich, zumindest in China: Für die Zahlungsbilanz sind die durch Auslandsinvestitionen aufgebauten Exportproduktionen negativ, laut UNCTAD eine Folge hoher Importanteile und repatriierter Gewinne. Beides ist typisch für die transnationalen Produktionsnetzwerke, die auf einer Aufteilung der Wertschöpfungskette auf die jeweils kostengünstigsten Standorte beruhen, ob im Textil- und Bekleidungshandel oder im Computer- und Elektronikgeschäft. 30 Prozent des Welthandels erfolgen innerhalb solcher Netzwerke.
Sollten jetzt immer mehr Entwicklungsländer auf arbeitsintensive Exportproduktionen mit geringen Qualifikationsanforderungen einsteigen, ohne dass die Märkte im Norden entsprechend geöffnet werden, könnte das auch im High-Tech-Bereich zu einem strukturellen Überangebot wie derzeit bei Kaffee führen. Die Verlierer wären besonders jene Entwicklungsländer, etwa in Lateinamerika, denen es nicht gelingt, nach dem Modell der „fliegenden Gänse“ in Ostasien auf Produkte höherer Wertschöpfung umzusteigen.
Gerade China, das nun der WTO beigetreten ist, wäre schlecht beraten, weiter auf die bisherige exportorientierte Industrialisierung zu setzen. Die mit Auslandskapital gegründeten Firmen in China erwirtschaften zwar rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, benötigen dazu aber nur ein Prozent aller Beschäftigten. Die Dutzenden Millionen Menschen, die in Zukunft ihre Arbeit verlieren dürften (insbesondere in ineffizienten Staatsbetrieben), werden in der Exportwirtschaft nicht unterkommen.
Eine weitere Forcierung der Exportproduktion ist jedenfalls nur zweckmäßig, wenn der Norden seinen Marktöffnungsversprechungen bei der letzten WTO-Konferenz in Doha auch Taten folgen lässt. Doch bisher ist davon wenig zu sehen, im Gegenteil. Die USA haben mit den „Schutzzöllen“ auf Stahl und mit den Anfang Mai von Präsident Bush abgesegneten massiven Landwirtschaftssubventionen jeden Zweifel beseitigt, worauf es in Washington ankommt: auf die Interessen der einflussreichen inländischen Lobbys. Nicht dass es jemals anders gewesen wäre. Aber die jüngsten Maßnahmen sind für den Rest der Welt wie ein Schlag ins Gesicht. Die „Entwicklungsrunde“ im Welthandel, über die derzeit am WTO-Sitz in Genf verhandelt wird, rückt damit weiter ins Reich der Träume.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.