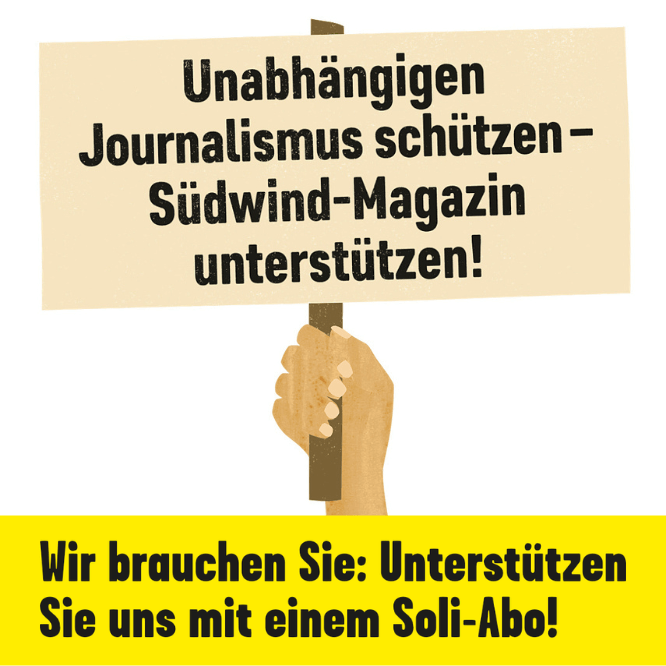Opfergabe und tägliches Brot
In Indien ist Reis allgegenwärtig – in Symbolen, Riten und als Grundnahrungsmittel. Gleichzeitig ist ein Drittel der Bevölkerung zu arm, um genügend Reis für den täglichen Verzehr beschaffen zu können. Gentechnologie wird dagegen ebenso wenig ausrichten können wie es die Grüne Revolution tat. Soziale Reformen großen Stils stehen nicht auf der Tagesordnung der Regierenden.
in welcher industrialisierten Gesellschaft du gelebt haben magst,
möge der Glanz, der Duft
das tiefe Gefühl deines Dorfes
immer mit dir sein“,
zitiert Madhavan Kutty einen Vers, der ihm, seit er ihn zum ersten Mal gehört hat, nie mehr aus dem Sinn gekommen ist. Sein Dorf, ein kleiner Ort im südindischen Bundesstaat Kerala, „Dorf vor der Zeit“ hat er es genannt, weil sich die über 50jährigen wie er noch erinnern können an eine Ära, da alles unveränderbar und seit jeher unverändert schien. Doch die Zeit hat es eingeholt, und mit ihr der stete Wandel. Was geblieben ist, sind die alten Rituale, wie Kutty, Publizist und Autor, bei einer nostalgischen Rückkehr nach langen Jahren feststellt. „Die Feste Nira und Puthiri werden zum Dank für die neue Ernte noch gefeiert. Ich konnte ihre Symbole an der Tür sehen – der Abdruck einer Hand, in Reismehlpaste getaucht, und eine Reisähre, die mit Kuhdung an den Türrahmen geklebt worden war.“
Der Reis war in Kuttys Kindheit allgegenwärtig. Draußen auf den Feldern, unter den Opfergaben für die Götter, als Grundnahrungsmittel, als unabdingbarer Bestandteil von Riten an den großen und kleinen Lebensstationen. Aber mit dem Reis sind auch andere Erinnerungen verbunden, an Dinge, die trotz der Ankunft der Zeit beharrlich konstant geblieben sind. Und wie lange werden sie es wohl noch bleiben?
Hat Indien am 15. August 1947 die Freiheit erlangt oder lediglich einen Machtwechsel erlebt, begannen schon bald nach der Unabhängigkeit die Kommunisten im Dorf zu fragen. Hatten sich viele BewohnerInnen des Subkontinents nicht am Freiheitskampf beteiligt in der Hoffnung, dass diese Freiheit auch die Befreiung der TagelöhnerInnen und KleinstpächterInnen aus ihrer Armut bringen würde? Soziale Gerechtigkeit hatte der Indische Nationalkongress schließlich schon knapp zwei Jahrzehnte vor der Unabhängigkeit als eines der vorrangigen Ziele seiner Wirtschaftspolitik verankert.
Es blieb nicht beim theoretischen Bekenntnis. Indiens über lange Jahre unangefochten alleinregierende „Kongresspartei“ hat tatsächlich viele Maßnahmen ergriffen. Entgegen den pessimistischen Prognosen führender Ökonomen ist es dem Land, das noch wenige Jahre vor der Unabhängigkeit eine verheerende Hungersnot mit an die drei Millionen Toten durchmachte, in den siebziger Jahren gelungen, bei seiner Reis- und Getreideversorgung autark zu werden. Entscheidend dafür war die so genannte Grüne Revolution mit dem Anbau wesentlich ertragreicherer Reis- und Getreidesorten. Vorausgegangen waren allerdings eine massive Verschuldung für jahrelange Nahrungsmittelimporte und zwei schlimme Missernten 1965 und 1966. Beide Male war ein schlechter Monsun der Auslöser gewesen und die Emanzipation von den jährlichen Regenfällen durch künstliche Bewässerung in der Folge als vorrangig erkannt worden.
Im März 2002 verfügt die Food Corporation of India (FCI) über 60 Millionen Tonnen an Reis und anderem Getreide, von denen 40 Millionen als Überschuss gelten. Große Hungersnöte dürften damit definitiv der Vergangenheit angehören. Aber ist die Nahrungssicherheit für alle BürgerInnen des Landes garantiert? Gibt es zu Beginn des dritten Jahrtausends tatsächlich keine Hungeropfer mehr in Indien, wie von den einzelnen Bundesstaaten vorgelegte Dokumente glauben machen wollen? Die Berichte wurden vom Obersten Gerichtshof auf eine Klage der People’s Union of Civil Liberties (PUCL) hin im Herbst des Vorjahres angefordert. Laut den Recherchen von PUCL waren in mehreren Bundesstaaten Menschen infolge Hungers gestorben. Die später präsentierten Berichte belegen den von der Bürgerrechtsorganisation erhobenen Vorwurf, wonach diverse Programme zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung von Millionen Menschen unter der Armutsgrenze nur zögerlich und unzureichend umgesetzt werden. Wenn schon offizielle Dokumente eine derartige Nachlässigkeit belegen, „bin ich mir sicher, dass die Lage vor Ort weitaus schlimmer ist“, äußerte Colin Gonsalves, ein Anwalt der PUCL, seine Sorge.
Diese Bedenken gemahnen an die Worte des aus Indien stammenden Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen. „Hungersnot bedeutet, dass ein Teil der Menschen nicht genug zu essen hat. Es heißt nicht, dass nicht genug Lebensmittel vorhanden sind“, erklärte Sen am Anfang seiner bahnbrechenden Studie über die Katastrophe in Bengalen 1943/44, deren Zeuge er als Kind war. Die Reisernte von 1943 war seinen Nachforschungen zufolge wesentlich höher als jene zwei Jahre davor gewesen. Grund der Hungersnot war die stark verringerte Kaufkraft der LandarbeiterInnen, deren Löhne weit hinter den kriegsbedingt rapide gestiegenen Lebensmittelpreisen zurück geblieben waren.
Heute steht fest, dass bei allen vorhandenen Überschüssen mehr als 35 Prozent der InderInnen in absoluter Armut leben, die meisten von ihnen in den rund 600.000 Dörfern des Landes. Im Zuge der nach der Unabhängigkeit durchgeführten Landreform wurden zwar gewisse Formen des Großgrundbesitzes wie das Zamindari- und Jagirdari-System abgeschafft und erwarben mehr als 20 Millionen Bäuerinnen und Bauern erstmals Besitz an dem Boden, den sie bestellten. Die am meisten Benachteiligten, die landlosen TagelöhnerInnen wie auch die EigentümerInnen winzigster Landfleckchen, fristen aber weiter ein von Unterbeschäftigung, unzureichenden Löhnen und Armut gekennzeichnetes Leben.
Auch die Grüne Revolution hat bei allen Erfolgen keineswegs zur sozialen Gerechtigkeit beigetragen, sondern die regionalen Disparitäten noch verschärft. Aufgrund der hohen Anforderungen wurde das Projekt vor allem in den bereits höher entwickelten nördlichen Bundesstaaten Punjab und Haryana sowie im westlichen Teil von Uttar Pradesh und in den Deltas des Südostens durchgeführt. In Zentral- und Ostindien wurde dagegen selbst in Zeiten eines landesweiten Wirtschaftswachstums ein Ansteigen der Armut registriert. Die Grüne Revolution führte, wie die international ausgezeichnete Umweltaktivistin Vandana Shiva beklagt, zudem „zu einer Abhängigkeit von Chemikalien und Krediten. Zumindest aber konnten die Bauern bei unwetterbedingten Ausfällen oder ungünstigen Preisniveaus von der Regierung einen Rückzahlungsaufschub für ihre Schulden einfordern und liefen damit kaum Gefahr, ihr Land zu verlieren. Zudem war das Saatgut öffentlich erhältlich, und die Bauern konnten ihre eigene Saat reproduzieren“, kommt Shiva auf das viel schlimmere Übel der Biotechnologie zu sprechen. „Der Gen-Reis bringt die Bauern in eine völlige Abhängigkeit von Großkonzernen“, kommentiert Shiva die üblichen Verträge, die Bauern dazu verpflichtet, nicht reproduzierbares Saatgut sowie alle erforderlichen Düngemittel beim jeweiligen Konzern zu erwerben. Ganz abgesehen davon, dass die mit der Grünen Revolution eingeleitete drastische Reduzierung der Sortenvielfalt mit der Biotechnologie weiter verschärft wird. Wenn dazu noch die Patentierung einheimischer Produkte wie des Basmatireises durch multinationale Unternehmen kommt, sieht Shiva schwarz für die Rechte der indischen Bäuerinnen und Bauern und die Zukunft der indischen Landwirtschaft.
Kein technologischer Fortschritt kann zudem die sozial Schwächsten aus der Armuts- und damit Hungerfalle retten. „Wie immer wir es betrachten: Dieses Land kann sich nur weiter entwickeln, wenn wir die Kaufkraft der benachteiligten Schichten in den ländlichen Regionen stärken“, sagt Prabhat Patnaik, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu Delhi. Dies aber würde tief greifende gesellschafts- und strukturpolitische Reformen erfordern – von der Art, wie sie bislang bestenfalls halbherzig angegangen wurden.
Solange das nicht geschieht, mögen zwar Rituale wie dieses bleiben: Wenn die Braut die Schwelle ihres neuen Hauses betritt, wirft sie mit ihrem Henna-verzierten Fuß eine eigens aufgestellte Schale mit Reis um. Die Körner, die in alle Richtungen ins Haus hinein rollen sollen, symbolisieren Glück und Reichtum. Mehr als ein Drittel der indischen Bevölkerung aber kann – unabhängig vom Stand der staatlichen Lagerbestände – weiterhin nicht damit rechnen, bei der nächsten Mahlzeit ausreichend Reis am Teller vorzufinden.
Brigitte Voykowitsch ist freie Journalistin mit dem Arbeitsschwerpunkt Süd- und Südostasien.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.