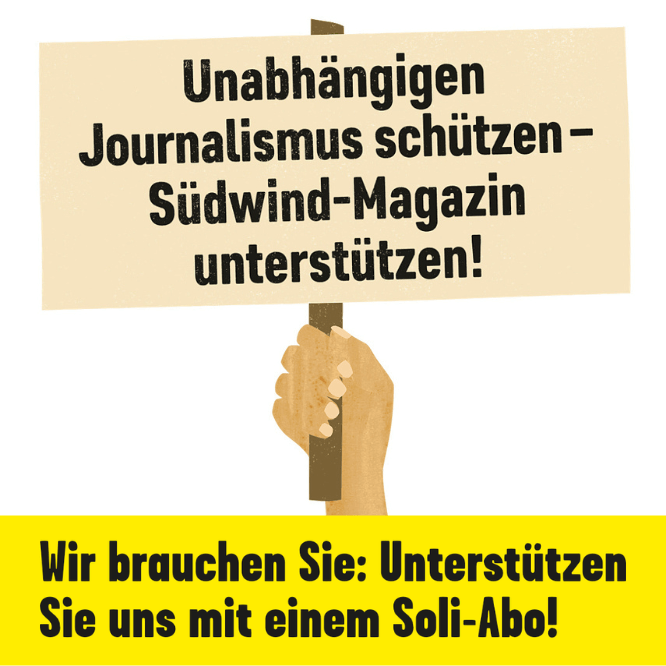Globalisierung werde allgemeinen Wohlstand, Freiheit und Frieden schaffen, auch für die armen Länder. Das wurde in den 1990er Jahren postuliert. Heute ist die Euphorie einer Ernüchterung gewichen. Die Armut hat sich mit dem Siegeszug der Globalisierung vergrößert statt verringert. Und es ist nicht vorstellbar, wie sie mit dem derzeitigen „Regulationsregime“ des Neoliberalismus dauerhaft beseitigt werden könnte.
In den 1990er Jahren war dies ganz anders. Dieselben Kreise beschworen nicht die Armut, sondern den wachsenden Reichtum, den die Globalisierung hervorbringen werde. Nach 1989 versprachen sie, ein von staatlicher Gängelung befreiter, globalisierter Kapitalismus würde allgemeinen Wohlstand bringen, Freiheit schaffen und Frieden stiften. Das Versprechen galt explizit auch für die Entwicklungsländer. Die Globalisierung würde die „Unterentwicklung“ ein für alle Mal überwinden. Damals wirkte die Utopie ziemlich unwiderstehlich. Nicht zuletzt, weil diverse Alternativen in den 1970er und 1980er Jahren diskreditiert worden waren. Weder der Staatskapitalismus unter dem Diktat kommunistischer Parteien oder ehemaliger Befreiungsbewegungen noch diverse „dritte Wege“ – wie etwa derjenige Tansanias mit seinem „afrikanischen“ Sozialismus – hatten gebracht, was sie der Doktrin nach hätten bringen sollen.
Die Globalisierungseuphorie verlor mit der Asienkrise von 1997/98 und dem Absturz der New Economy beträchtlich an Glaubwürdigkeit, desgleichen die damit verknüpften wirtschaftspolitischen Doktrinen. Seither steht ein bestimmtes Regulationsregime des Kapitalismus zur Diskussion, das in den Industriestaaten mit der anti-keynesianischen Wende in der Ökonomie und Wirtschaftspolitik in den 1970er Jahren begonnen und in den 1990er Jahren seinen Höhepunkt erreicht hat. Dieses „neoliberale“ Regulationsregime hat ebensowenig Ewigkeitscharakter wie die vorangegangenen Regime. Alternativen dazu sind nicht nur denkbar. Sie werden irgendwann auch realisiert. Es fragt sich nur welche. In der Auseinandersetzung zwischen GlobalisierungskritikerInnen und BefürworterInnen oder im Streit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern in der Welthandelsorganisation (WTO) geht es genau darum. Oder, auf die Millenniumsziele bezogen, darum, wie die Armut wirksam zurückgedrängt werden soll, wenn die vorherrschende Wirtschaftspolitik der permanenten Liberalisierung ad infinitum fortgesetzt wird.
Das neoliberale Regulationsregime zeichnet sich international durch drei Punkte aus:
1) durch die vollständige Deregulierung des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs, die ab Ende der 1980er Jahre von den Industriestaaten, allen voran der USA, eingeführt wurde;
2) durch eine weitgehende Liberalisierung des Außenhandels und durch die 1995 gegründete WTO, deren Regeln einzelstaatliches Recht zur Regulierung der nationalen Märkte brechen;
3) durch die Verlagerung wirtschaftspolitischer Entscheidungen von der nationalen auf die internationale Ebene. Sie sollte die Marktkräfte vom Gängelband der (nationalen) Politik befreien. Sie führte aber – unbeabsichtigt – zur Politisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
Dieses Regulationsregime wurde einer ganzen Gruppe meist schwächerer Entwicklungsländer von außen aufgezwungen. Sie waren in der Schuldenkrise ab 1982 an den Rand des Staatsbankrotts geraten und von Umschuldungen und Neukrediten der Industrieländer abhängig geworden. Ihre Wirtschaftspolitik wird seither durch die Weltbank, den IWF und die Gläubiger diktiert. Diese setzten die Öffnung der nationalen Kapital- und Gütermärkte für die internationale Konkurrenz durch, was die Anfälligkeit für Finanzkrisen erhöht und vielerorts lokale Industrien und verarbeitendes Gewerbe ruiniert oder in die informelle Wirtschaft abgedrängt hat. Sie verlangten eine neue Geld- und Fiskalpolitik, die sich an der Preisstabilität orientiert und eher rezessiv wirkt. Sie verlangten, die aktive staatliche Industrialisierungspolitik zu beenden, und pochten stattdessen auf einen institutionellen Ausbau, der Privatinvestitionen, vor allem von Auslandkapital, fördern sollte. Um Devisen zu verdienen und die Schulden zu bedienen, wurden die Länder schließlich gezwungen, Exporte zu fördern, welche ihrem sogenannten komparativen Vorteil entsprechen. Das mündete oft in die Weiterentwicklung ehemals kolonialer Produktlinien im Agrarsektor, dem Bergbau oder dem Holzschlag.
Über die Resultate dieser „strukturellen Anpassung“ ist niemand recht glücklich, nicht einmal diejenigen, die sie verordnet haben. Das Hauptziel, nämlich ein höheres und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wurde deutlich verfehlt. Die Gruppe der wirtschaftspolitisch abhängigen Entwicklungsländer erzielte in den vergangenen 25 Jahren deutlich niedrigere Wachstumsraten als in der keynesianischen Ära von 1950-1980. Kein Wunder, dass sich in diesen Ländern die bitterste Armut, welche die Millenniums-Entwicklungsziele bekämpfen wollen, nicht verringert hat.
In Kontrast dazu stehen die erfolgreichen Entwicklungsländer Ost- und Südostasiens und das seit wenigen Jahren hochgelobte Indien. Die Wirtschaftspolitik dieser Länder ist nach 1982 nicht von Washington diktiert worden. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem weil sie 1982 zahlungsfähig geblieben sind. Diese Länder setzten ihre Entwicklungsstrategien fort, in denen staatliche Interventionen eine herausragende Rolle spielten. Die (süd)ostasiatischen Eliten verfolgten ihre Variante eines starken Entwicklungsstaats, der sich am Beispiel der nachholenden Industrialisierung Japans orientierte und die Protektion des Binnenmarkts mit der staatlichen Förderung von weltmarkt-, also exportfähigen Unternehmen kombinierte. Indien führte die ganzen 1980er Jahre seine klassische Importsubstitutionsstrategie fort, bevor es seine Wirtschaft in den 1990er Jahren graduell dem Weltmarkt öffnete.
Die Praktiken der erfolgreichen „Entwicklungsstaaten“ sind seit den 1980er Jahren den Industrieländern ein Dorn im Auge. Als sich der Zusammenbruch der Sowjetunion abzeichnete, drängten die USA die asiatischen Verbündeten, ihre Märkte endlich zu öffnen und die staatlichen Interventionen zurückzufahren. Diesem Zweck dienten die Liberalisierungen im Kapitalverkehr, welche auch die asiatischen Entwicklungsländer auf Druck hin einführten. Ausnahmen stellten etwa China und Indien dar. Sie blieben deshalb von der großen Finanzkrise 1997/98 verschont.
Der Demontage des „Entwicklungsstaats“ dienen auch zentrale Vertragsbestandteile der WTO. Weitere einschränkende Regeln wollten die Industrieländer in der neuen WTO-Verhandlungsrunde durchsetzen. Das ist einer der Gründe, wieso die Ministerkonferenz in Seattle 1999 platzte und der Streit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern in der WTO eskalierte.
Würde das gegenwärtige Regulationsregime die nächsten Jahrzehnte andauern, ist schwer vorstellbar, wie die ärmeren Entwicklungsländer allein oder im regionalen Verbund eine nachholende Industrialisierung schaffen sollen. Denn das Instrumentarium, das dazu nötig wäre, ist unter der Androhung des Ausschlusses vom Weltmarkt verboten. Zudem wäre es möglich, dass die asiatischen Erfolgsländer, weil sie ihren „Entwicklungsstaat“ zurückfahren müssen, Rückschläge erleiden und auf einem untergeordneten Platz in der internationalen Arbeitsteilung stagnieren. In diesem Fall gäbe es wenig Hoffnung, dass sich die gesellschaftliche Teilung Indiens oder Chinas überwinden lässt – eine Minderheit bliebe in die Weltwirtschaft integriert, die Mehrheit wäre davon ausgeschlossen. Asien würde sich „lateinamerikanisieren“.
Gegen das Korsett der total integrierten Weltwirtschaft wehren sich die Entwicklungsländer seit geraumer Zeit mit der Forderung nach mehr policy space, nach mehr wirtschaftspolitischem Spielraum. Der amerikanische Ökonom Dani Rodrik spricht in diesem Zusammenhang vom „politischen Trilemma der globalen Wirtschaft“. Die drei Zielsetzungen
1) volle wirtschaftliche Integration aller Länder,
2) Ausbreitung demokratischer Politik und
3) Selbstbestimmung im Rahmen von Nationalstaaten lassen sich nicht alle gleichzeitig verwirklichen. Nur je zwei können kombiniert werden.
Heute ist die Wirtschaft global integriert, während die politischen Entscheidungsprozesse national ablaufen. In dieser Kombination sorgt die „goldene Zwangsjacke“ globaler Finanzmärkte dafür, dass die nationalen Entscheidungsprozesse nicht gegen die Erfordernisse der globalen wirtschaftlichen Integration verstoßen: Fiskal-, umwelt- oder sozialpolitische nationale Entscheidungen können durch massive Kapitalflucht und Währungsspekulation innerhalb von Monaten zu Fall gebracht werden, falls sie im Urteil der Herde der Finanzmarkt-Investoren gegen die „Rationalität“ der global integrierten Wirtschaft verstoßen. Dadurch wird der Spielraum für demokratische Politik drastisch eingeschränkt.
Werden nationale Selbstbestimmung und Demokratie als Zielsetzungen bevorzugt, muss die Integration der Weltwirtschaft begrenzt werden. Rodrik postuliert deshalb einen neuen Bretton-
Woods-Kompromiss, in Analogie zum alten Bretton-Woods-Kompromiss von 1945, der dem keynesianischen Regulationsregime den notwendigen internationalen Rahmen verschaffte. Viele Reformvorschläge, die in den letzten Jahren von einzelnen Regierungen von Entwicklungsländern, von kritischen Ökonomen, von Tausenden von Basisbewegungen im Süden und Norden und von der globalisierungskritischen Bewegung geäußert wurden, laufen in eine solche Richtung. In Diskussion stehen etwa eine Re-Regulierung der Finanzmärkte, geringere Kompetenzen für die WTO und größere Spielräume für nationale Wirtschaftspolitik, Machtverschiebungen in den Bretton-Woods-Institutionen (Weltbank und IWF) zugunsten der Entwicklungsländer und die Abschaffung der makroökonomischen Konditionalitäten.
Ein neuer Bretton-Woods-Kompromiss ist keine Zwangsläufigkeit. Andere Zukunftsszenarien sind denkbar. Das gilt erst recht seit dem 11. September 2001. Je mehr die internationale Politik und die Lage einzelner Länder durch den „Krieg gegen den Terrorismus“ bestimmt werden, desto stärker dürften soziale und politische Kräfte werden, welche eine militante nationale, kulturelle oder religiöse Renaissance anstreben. Solche Kräfte betrachten die kapitalistische Weltwirtschaft als Kampfplatz aller gegen alle, auf dem jedes Land um das eigene Überleben kämpft.
Ein neuer Bretton-Woods-Kompromiss ist jedoch möglich. Er liegt im Interesse der meisten Entwicklungsländer, weil er ihre Entwicklungschancen vergrößern würde. Er kommt auch wesentlichen Kreisen in den Industrieländern entgegen. Sei es aus materiellen Gründen, da sie nicht transnational mobil sind und die „goldene Zwangsjacke“ ihre ökonomische Sicherheit untergräbt. Sei es aus ideellen Gründen, weil ihnen der soziale Darwinismus oder die kämpferische Gier zuwider sind, die die Kultur der wirtschaftlichen Globalisierung ausmachen. Sich dafür einzusetzen, national und international, ist in den Industriestaaten auch eine wirksame Möglichkeit, gegen die Weltangst und die Allmachtsphantasien eines neuen „liberalen“ Imperialismus vorzugehen und das Unternehmen „Krieg gegen Terrorismus“, das die Administration Bush auf dreißig Jahre angelegt hat, rechtzeitig zum Abbruch zu bringen.
Peter Niggli ist Geschäftsleiter von Alliance Sud, der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft der großen schweizerischen Hilfswerke.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.