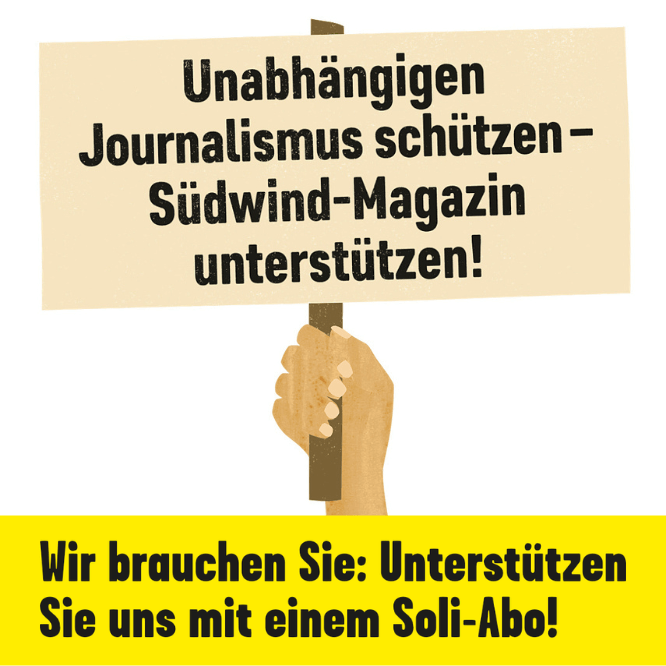Der Rassismus nordafrikanischer Länder gegenüber Menschen aus Afrika südlich der Sahara äußert sich in den Zeiten der Revolution besonders drastisch.
Sie sind die vergessenen Opfer des libyschen Konflikts: Hunderttausende MigrantInnen aus Afrika südlich der Sahara, die angelockt von Wohlstandsversprechen Gaddafis nach Libyen zogen und jetzt, in den Zeiten der Demokratiebewegung und des bewaffneten Konflikts, zu Sündenböcken gestempelt werden. Zehntausende schwarze AfrikanerInnen mussten in den Wochen nach Beginn des libyschen Aufstands Mitte Februar das Land verlassen, teils auf abenteuerlichen Wegen durch die Sahara, teils als benachteiligte TeilnehmerInnen der Flüchtlingskolonnen nach Tunesien oder Ägypten. Manche afrikanischen Staaten schickten zwar Flugzeuge, um ihre vertriebenen StaatsbürgerInnen zu repatriieren, aber nicht alle konnten sich das leisten. Und im Land harren noch viel mehr aus, die sich verstecken müssen und um ihr Leben fürchten.
Libyens Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi hatte es sich Ende der 1990er Jahre, nachdem er von der arabischen Welt restlos enttäuscht war, zum Ziel gesetzt, Afrika unter seine Fittiche zu nehmen. Er stand Pate bei der Gründung der Afrikanischen Union (AU), der Nachfolgeorganisation der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), und vor allem nahm er unzählige afrikanische GastarbeiterInnen auf. Zum einen als billige Arbeitskräfte, ähnlich wie Pakistanis und Filipinos in den arabischen Golfstaaten; zum anderen als Symbol des Panafrikanismus und Bestätigung seiner eigenen Glorie – und, wie er schnell merkte, als Druckmittel gegen Europa, das Angst vor afrikanischen MigrantInnen hatte und bereit war, mit Gaddafi zusammenzuarbeiten und ihm militärisch und finanziell unter die Arme zu greifen, damit er als Europas Gendarm Flüchtlinge abhält.
Bereits im Jahr 2000 gab es massive Pogrome gegen schwarze AfrikanerInnen in Libyen, bei denen Hunderte starben. Tausende von Menschen wurden danach in ihre Heimatländer repatriiert, unter teils abenteuerlichen Umständen. Nichtsdestotrotz verstärkte Gaddafi danach sein Werben um afrikanische Potentaten und, als kluger Machtpolitiker, auch um deren schärfste Gegner. Von den Rebellen der RUF (Revolutionäre Vereinigte Front) in Sierra Leone bis zum jungen König von Toro in Uganda reichten die Nutznießer seiner Gunst, die sich zunehmend auch in Investitionen und Geschäften mit Diktatoren äußerte. Und gerade im Sahelraum förderte Gaddafi immer wieder bewaffnete Aufstände, um die Regierungen von Ländern der Region wie Tschad, Mali und Niger erst zu schwächen und dann als auf sein Wohlwollen angewiesene Partner an sich zu binden.
Kein Wunder, dass heute zahlreiche Männer aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara für Gaddafi in Libyen kämpfen, angelockt von fetten Salären und Versprechungen einer Vorzugsbehandlung – und dass Libyens Opposition pauschal alle schwarzen AfrikanerInnen als Söldner verdächtigt und diejenigen tötet, derer sie habhaft wird.
Ein ehemaliger Führer der Tuareg-Rebellen Nigers im libyschen Exil soll die Söldneranwerbung koordinieren, hieß es im April in Berichten aus Tripolis. Immer wieder werden BürgerInnen afrikanischer Staaten von libyschen Aufständischen gefangen genommen, misshandelt und dann entweder als Söldner umgebracht oder als Flüchtlinge abgeschoben. Selbst die Freiheitskämpfer aus Darfur im Sudan haben sich dadurch kompromittiert, dass sie Gaddafis Asyl und Unterstützung annehmen – der Libyer sichert sich dadurch ein Mitspracherecht bei der Zukunft Sudans.
Im libyschen Volksempfinden zieht das alles aber nur, weil viele AraberInnen gemeinhin AfrikanerInnen ohnehin als minderwertige Wesen ansehen. Jahrhundertelang waren die AfrikanerInnen des Südens Objekte des arabischen Sklavenhandels. Dass im Sudan die schwarze Bevölkerung der Südhälfte jahrzehntelang gegen Unterdrückung rebellierte und erst dieses Jahr endlich ihre Unabhängigkeit erlangt (siehe SWM 2/11), wirft ein Schlaglicht darauf, dass die Beziehungen zwischen AraberInnen und AfrikanerInnen in Nordafrika oft noch heute viel rückständiger sind als in Europa selbst.
In allen Ländern des Maghrebs werden schwarze AfrikanerInnen routinemäßig als „abid“ bezeichnet – das arabische Wort für „Sklave“. Afrikanische MigrantInnen, die auf dem Weg nach Europa in Nordafrika stranden, sind mehrheitlich Opfer primitivsten Rassismus: Die Schwarzen hätten alle Aids, seien unverbesserlich der Vielweiberei zugetan, seien keine echten Muslime und hätten sowieso nichts zu sagen, weil sie keine Träger einer eigenen stolzen Kultur sind – solche Attitüden sind verbreitet unter der arabischen Mehrheitsbevölkerung in Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten und Sudan. Die hochkarätigen Kader der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), die aus der Elfenbeinküste nach Beginn des dortigen Bürgerkrieges 2002 in das sichere Tunesien ziehen mussten, können davon ebenso ein Lied singen wie die NigerianerInnen und KamerunerInnen, die in den Wäldern an der marokkanisch-algerischen Grenze wie Tiere ihr Leben fristen, oder die verängstigten Flüchtlinge, die sich in Libyen heute der Lynchjustiz erwehren müssen.
Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur der Berliner Tageszeitung taz.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.