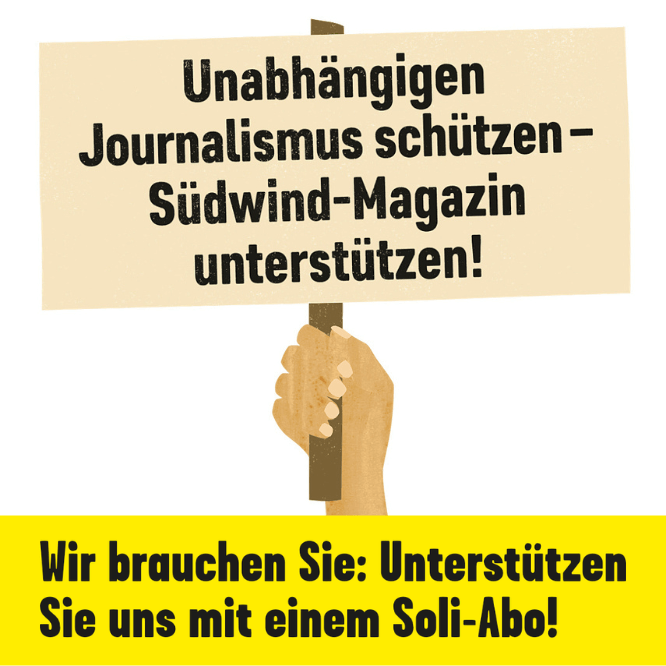Vielfalt der Kulturen – Auf dem Markt der Kulturen
Ist ein Filipino, der Coca Cola trinkt, ein US-Amerikaner? Oder: Gibt es bereits die Welt-Einheitskultur? Die Vielfalt der Lebensweisen stellt sich wirksam gegen die Vereinheitlichung durch ökonomische (und auch durch entwicklungspolitische) Kräfte. Trotzdem ist die Vielfalt bedroht.
Doch der Schein trügt: Von der Durchsetzung einer einheitlichen Weltkultur sind wir weit entfernt. Die einschlägige Forschung spricht von „Glokalisierung“, um die paradoxe Art und Weise einzuordnen, wie verschiedene lokale Gruppen mit denselben, scheinbar globalen Produkten umgehen. Ein Filipino, der Coca Cola trinkt und sich „Titanic“ anschaut, ist eben noch lange kein US-Amerikaner. Alleine an der Art, wie in verschiedenen Weltregionen Autos verwendet werden, lässt sich dies beobachten: Während in unseren Breitengraden individuelle Nutzung, nicht zuletzt als Statusmerkmal, vorwiegt, so werden viele Kraftfahrzeuge in peripheren Regionen kollektiv genutzt und grundsätzlich überladen.
Kultur und Entwicklung ist als Thema in der entwicklungspolitischen Diskussion en vogue. Nicht zuletzt die Debatte um die vielbeschworene und -befürchtete Globalisierung hat zu einem neuen Interesse an soziokulturellen Faktoren und so genannten kulturellen Fragmentierungen geführt.
Eine äußere Angleichung Wndet tatsächlich statt, und so gut wie ständig erlischt irgendwo auf der Welt eine Sprache mit dem Tod ihres letzten Sprechers oder ihrer letzten Sprecherin. Ich halte es für naiv, anzunehmen, der Prozess der Globalisierung stelle keine Bedrohung für die Vielfalt der Kulturen dar. Im Endeffekt führt das, was euphemistisch als „Entdämonisierung der Globalisierung“ bezeichnet wird, zu einer Rechtfertigung der Globalisierung. Diese umfasst aber eben nicht nur die weltweite Verbreitung von bestimmten kulturellen Produkten wie Filmen, Autos, Nahrungsgewohnheiten, sondern die Ausbreitung einer ganz bestimmten politischen und ökonomischen Hierarchie.
Globalisierung ist weniger ein „empirisch“ beobachtbares Phänomen als vielmehr eine Ideologie, mit der die Durchsetzung restriktiver Politiken legitimiert wird: Nationalstaaten treten zumindest scheinbar in den Hintergrund und werden als Spielbälle der mächtigen Kapitalströme betrachtet, wirtschaftliche Liberalisierung und Sozialabbau zur Naturnotwendigkeit erklärt. Der „eine Markt“, mit seinem Anspruch auf globale Ausdehnung, hängt mit der Durchsetzung der „einen Kultur“ insofern zusammen, als hier die Realisierung der „einen Konsumgüterkultur“ beabsichtigt wird. Auf welche Art und Weise ein Auto genutzt wird, ist dem Automobilhersteller letztlich egal, solange nur seine Autos gekauft werden.
Worum es bei Globalisierung und in weiterer Folge auch bei „kultureller Globalisierung“ geht, sind Fragen von Macht und Ressourcenverteilung. Darin liegt denn auch eine besondere Falle jeder Beschäftigung mit Kultur, dass dabei Machtaspekte ausgeblendet werden. Kulturaustausch kann eine Auseinandersetzung mit dem politischen Kontext, in dem diese Kunst entsteht, einschließen, kann diesen Kontext aber auch ignorieren. Anstelle einer politisierenden Praxis und einer Anregung zur Reflexion gerät zum Beispiel „Weltmusik“ dann zum exotischen Element, das ebenso wie die Küche fremder Länder bedenkenlos konsumiert werden kann. Kunst als Trost und Betäubung war den Herrschenden schon immer recht, ist sie doch nur die kultiviertere und feinere Variante von „Brot und Spielen“ für die Masse.
Umgekehrt aber kann künstlerische Produktion sehr wohl eine bedeutende Funktion in der Auseinandersetzung um Macht und Ressourcen haben, und damit meine ich nicht Revolutions-Propaganda, die auf ästhetische Mittel zurückgreift. Der italienische Politiker und linke Theoretiker Antonio Gramsci hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Kultur ein Feld ist, auf dem Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Interessengruppen ausgetragen werden. Man kann sich das als ein Fußballfeld vorstellen, auf dem anstelle zweier Mannschaften zum Beispiel Unternehmer gegen ArbeiterInnen spielen. Nennen wir dieses Fußballfeld „Kultur“ und schon wird der Kulturbetrieb zur gigantischen Arena aller relevanter Auseinandersetzung.
Freilich ist das Spiel nicht so einfach zu deuten wie ein Ergebnis beim Fußball, das schlussendlich bei allem Interesse für ästhetische Kapriolen auf dem Rasen immer quantifizierbar ist. Der Kulturbetrieb ist komplexer, die verwendete Sprache grundsätzlich eine Verschlüsselung. Schließlich wird ja auch gleichzeitig auf mehreren Rasenflächen gespielt, denn neben der Ebene der repräsentativen Eliten-Kultur („E-Musik“ etc.) gibt es den alternativen Bereich („U-Musik“), aber auch die populäre Massenkultur („Musikantenstadl“ etc.).
Noch einmal möchte ich das Feld öffnen: Kultur ist nicht Kultur, und jenes Wort, das in einem engeren Sinn sehr bestimmte und eingrenzbare Phänomene der Kulturproduktion bezeichnet (Musik, bildende Kunst, Literatur …), kann man in einem weiteren Sinn auf so gut wie alle Phänomene des Lebens beziehen: Nicht nur Picasso und Bach sind Kultur – auch das Auto, die Höflichkeit, religiöse Haltungen, Heizsysteme, Sexualpraktiken und Hygienevorstellungen.
Was ich alles zur Kultur zähle, fällt mir erst in der Konfrontation mit einer mir fremden Kultur auf, insbesondere wenn ich Fehler mache. Als Missionare im letzten Jahrhundert in peripheren Regionen die Menschen zu „Sauberkeit“ und „Sparsamkeit“ angehalten haben, haben sie mitunter eine Kulturveränderung bewirkt, die folgenschwerer als ihre Glaubensverbreitung war. EntwicklungsarbeiterInnen setzen heute diese Tradition fort, wenn sie einkommensschaffende Projekte oder Bildungsprogramme für Frauen initiieren. Entwicklungszusammenarbeit ist immer kulturrelevant.
Ein Beispiel: Tief im Amazonas wurde ein Gesundheitsposten aufgebaut. Die Indios aber, für die dort gearbeitet werden sollte, waren von der Wirksamkeit der medizinischen Hilfe nicht sehr überzeugt. Das Gesundheitspersonal hatte ihnen erklärt, dass Krankheiten mit Viren, nichts aber mit Geistern und Dämonen zu tun haben. Das Gesundheitsprogramm scheiterte, weil beide Seiten nichts mit dem Krankheitsbegriff der anderen anzufangen wussten.
Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein: Kulturelle Faktoren müssen in der Entwicklungsarbeit berücksichtigt werden. Andernfalls droht das Scheitern vieler gut gemeinter Projekte, wie das Beispiel veranschaulicht. Gleichzeitig stellen sich hier einige schwer wiegende Fragen an Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation: Hätte das Personal des Gesundheitspostens die Vorstellungen übernehmen sollen, dass Dämonen Ursache der Krankheiten sind? Oder hätte es zumindest so tun sollen als ob, mit einem ethischen Dilemma als Folge?
Wer jemals mit Angehörigen indigener Völker zusammengearbeitet hat, weiß, dass interkulturelle Zusammenarbeit mehr ist als die Wertschätzung von fremden Speisen und Bräuchen, mehr als die abwechslungsreiche Erbauung des Gemüts an folkloristischen Darbietungen. Eine fremde Kultur ernst zu nehmen, erfordert ein Eintauchen, das nicht selten die Personen zu verschlingen droht. Wer mit Geistern und Dämonen Umgang pflegte, wird sich nicht so schnell wieder auf die technische Logik des westlichen Alltags umstellen können.
Fremde Kulturen können radikal anders sein, und das kann die Neigung, Kultur in der Entwicklungsarbeit zu respektieren, deutlich schmälern. Aus dem Westen stammende EntwicklungsarbeiterInnen sind nicht nur dadurch herausgefordert, dass viele fremde Kulturen alles und jedes mit religiösen Kategorien verbinden, sondern auch durch die getrennte Lebenswelt von Frauen und Männern oder auch durch den Vorrang der Alten vor den Jungen. Radikal fremd sind nicht nur die Kulturen indigener Völker, sondern auch jene von Kleinbauern oder städtischen Gruppen. Auch der Slum kennt andere Gesetze als jene unseres österreichischen Alltags.
Eine spezifische Kultur ist immer ein partikularer Ansatz der Weltdeutung und bezieht sich nur auf eine bestimmte abgrenzbare Gruppe. Dem Partikularismus kann der universalistische Ansatz, den die Menschenrechte oder die Vereinten Nationen oder auch die Tradition der Aufklärung beanspruchen, gegenübergestellt werden. Auch die Ideologie der Globalisierung reiht sich in diesen Reigen des Universalismus ein. Doch zeigt sich gerade an diesem Beispiel, wie dünn die universalistische Zierdecke in Wirklichkeit ist. Ebenso geht aber auch die Forderung, eine weltweite Gerechtigkeit durchzusetzen, die insbesondere von den entwicklungspolitischen Solidaritätsbewegungen vertreten wird, auf diesen universalistischen Grundgedanken zurück und steht damit in Widerspruch zum partikularistischen Ansatz, der die jeweiligen spezifischen Kulturen respektieren möchte. Deshalb ist die Forderung nach soziokultureller Anpassung von Entwicklungsmaßnahmen – so sehr sie mittlerweile auch Eingang in die Rhetorik der Entwicklungsszene gefunden hat – alles andere als selbstverständlich.
Nicht zuletzt sind ja auch die beiden geistesgeschichtlichen Stränge, auf die die Entwicklungszusammenarbeit zurückgeht, universalistisch ausgerichtet: Sowohl das Christentum als auch die linke Tradition verheißen die Erlösung für alle.
Die linken, kritischen Ansätze unter den Entwicklungstheorien (Theorien des Imperialismus und Neoimperialismus oder die lateinamerikanischen Dependenztheorien) haben deshalb konsequenterweise kulturellen Faktoren ein geringes Gewicht in Entwicklungsprozessen zugesprochen. Ganz im Gegenteil: Von Autoren wie Frantz Fanon („Die Verdammten dieser Erde“) wurde die These vertreten, die spezifischen Kulturen seien nichts anderes als durch die Kolonialmächte erzeugte Angstbilder. Nicht zuletzt wurde damit auf die Herangehensweise der konservativen Entwicklungstheorien reagiert: In den meisten Modernisierungstheorien wurde Kultur nämlich sehr genau analysiert und ausgesprochen kultursensibel gedacht.
Allerdings geht es manchen Autoren wie zum Beispiel Samuel Huntington weniger darum, die Einheimischen in ihrer jeweiligen Lebensführung zu respektieren, als darum, die jeweilige Kultur zu instrumentalisieren oder zu „überwinden“. Beides braucht aber eine gute Kenntnis der vorhandenen Kulturen. Diese wurde zumeist von Ethnologen eingebracht, die sich dadurch zu Kollaborateuren der Herrschenden machten.
Einige indigene Völker habe es sich abgewöhnt, Fremden ihre Sprache zu lehren. Sie wissen, dass sie ihre Kultur nur schützen können, wenn sie verborgen bleibt. Damit verhindern sie, dass sie von den Angehörigen der so genannten Globalkultur entziffert und begrifflich vereinnahmt werden können. Die Behauptung der eigenen Partikularität sind sie nicht nur ihren Ahnen und Gottheiten schuldig. Sie stellt, wenn dabei auch ihr ökonomisches System funktionsfähig bleibt, häufig die einzige Chance dar, nicht als billige, verelendete Arbeitskraftreserven für die global vernetzte (Plantagen-) Ökonomie missbraucht zu werden. Die Vielfalt der Sprachen stellt insofern nicht nur einen ästhetischen Reichtum dar, zur Freude von EthnologInnen und SprachwissenschafterInnen. Sie ist auch eine Ressource, an der Grenzen des scheinbar Globalen sichtbar werden und sich scheinbar universelle Konzepte unter Umständen auch einen Verweis auf ihre eigenen Partikularität gefallen lassen müssen.
ZUM WEITERLESEN
Gerald Faschingeder:
Kultur und Entwicklung. Zur Relevanz soziokultureller Faktoren in hundert Jahren Entwicklungstheorie.
Verlag Südwind/Brandes & Apsel, Wien/Frankfurt a.M., Mai 2001, cirka öS 291,-
Rainer Tetzlaff (Hg.):
Weltkulturen unter Globalisierungsdruck. Erfahrungen und Antworten aus den Kontinenten.
Texte der Stiftung Entwicklung und Frieden, Band 9, Bonn 1999, 384 Seiten, öS 181,-
Der Autor ist Historiker und Mitglied des Mattersburger Kreises für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten. Er arbeitet für die Margareta-Weisser Stiftung für indigene Völker in Asien sowie für die Dreikönigsaktion der Katholischen Jung
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.