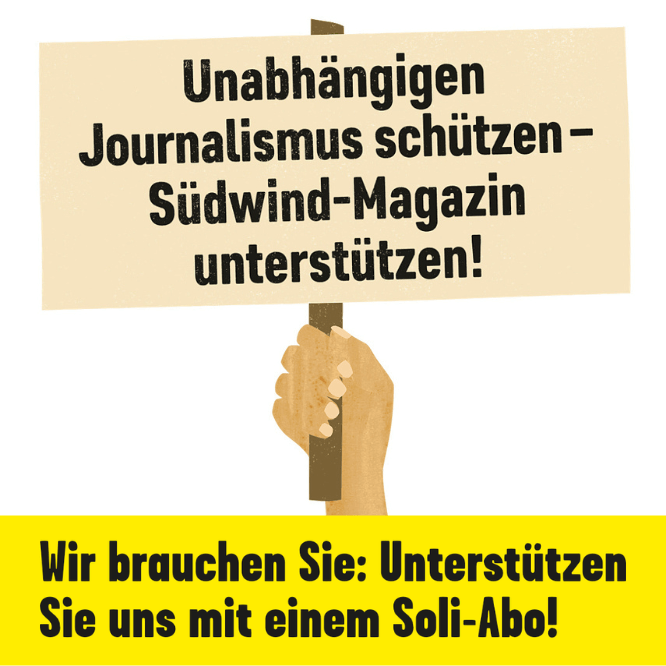Die Abwässer unserer hoch entwickelten Gesellschaften fördern eine explosive Vermehrung primitiver Organismen. Die Evolution läuft rückwärts, konstatiert Kenneth R. Weiss.
In den letzten zehn Jahren bedeckte das algenähnliche Gewächs immer wieder mehrere Quadratkilometer der Bucht, färbte die Fischernetze dunkel-purpurrot und überzog sie mit einem pulvrigen Belag. Beim Ausschütteln der Netze schnürten sich die Kehlen der Fischer zusammen, und sie bekamen kaum Luft. Einige begingen einen noch schmerzhafteren Fehler: Sie vergaßen, sich die Reste von den Händen zu waschen, bevor sie sich über die Bordwand ins Meer erleichterten. Eine Zeitlang schämten sie sich zu sehr, um ihre Beschwerden öffentlich zu machen. Als sie es schließlich taten, wollten ihnen die Behörden nicht glauben – bis ein Büschel des haarigen Gewächses ins meeresbotanische Labor der Queensland University gelangte.
Proben in einem Trockenofen gaben einen Rauch ab, der ProfessorInnen und StudentInnen würgend und hustend ins Freie flüchten ließ. Die Forscherin Judith O’Neil untersuchte eine winzige Probe unter dem Mikroskop und sah sich die langen, schwarzen Fasern näher an. Sie identifizierte das Kraut als Cyanobakterium, einen Vorläufer der heutigen Bakterien und Algen, der seine Blütezeit vor etwa 2,7 Milliarden Jahren hatte.
Der giftige Organismus, unter BotanikerInnen als Lyngbya majuscula bekannt, tauchte bereits an zumindest einem Dutzend anderen Orten der Welt auf. Er ist eines von vielen Symptomen einer virulenten Krankheit der Meere. An vielen Orten – bei den Atollen des Pazifik, in den Garnelenfanggebieten der US-Ostküste, in den norwegischen Fjorden – kämpfen einige der höchst entwickelten Meereslebewesen ums Überleben, während die primitivsten blühen und gedeihen. Fische, Korallen und Meeressäugetiere sterben, während sich Algen, Bakterien und Quallen ungehindert vermehren. Wo sich dieses Muster am deutlichsten abzeichnet, sprechen WissenschaftlerInnen von einer rückwärts laufenden Evolution, zurück zu den urzeitlichen Meeren vor hunderten Millionen Jahren.
Was wir erleben, sagt Jeremy B.C. Jackson, ein Meeresökologe und Paläontologe an der Scripps Institution of Oceanography im kalifornischen La Jolla, ist „the rise of slime“ – „der Aufstieg des Schlamms“. Lange ging man davon aus, dass die Ozeane zu groß wären, um vom Menschen nachhaltig geschädigt zu werden. Selbst als das Bewusstsein über die Kapazität des Menschen, dem Meer zu schaden, durch auslaufendes Öl, Chemieabwässer und Industrieunfälle zunahm, wurden die Folgen als vorübergehend betrachtet.
Mit der Zeit jedoch hat die Akkumulierung der Umweltschäden die Chemie der Meere grundlegend verändert: Der Ozean bietet heute primitiven Organismen bessere Lebensumstände, weil das Wasser mit Nahrung angereichert wurde. Die Industriegesellschaft führt dem Ozean zu viele grundlegende Nährstoffe zu – die Stickstoff-, Kohlenstoff-, Eisen- und Phosphorverbindungen, die aus Schornsteinen und Auspuffrohren entweichen, aus gedüngten Rasenflächen und Ackerland ins Meer gewaschen werden, aus Klärtanks sickern und sich aus Abwasserrohren ergießen.
Industrie und Landwirtschaft produzieren heute mehr gebundenen Stickstoff – vor allem Düngemittel – als alle natürlichen Prozesse an Land. Millionen Tonnen Kohlendioxid und Stickoxide aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe werden täglich vom Ozean absorbiert. Diese Stoffe ermöglichen ein übermäßiges Wachstum schädlicher Algen und Bakterien. Gleichzeitig haben Überfischung und die Zerstörung von Feuchtgebieten die mit ihnen konkurrierenden Lebewesen im Meer dezimiert und die natürlichen Puffer beseitigt, die früher Mikroben und schädliche Gewächse unter Kontrolle hielten. Die Folgen sind überall auf der Welt zu sehen. Jeden Sommer verwandeln aufblühende Kulturen von Cyanobakterien die Ostsee in einen stinkenden, gelbbraunen Schlick, der von Einheimischen „Rhabarbersuppe“ genannt wird. An der Golfküste Floridas beklagen sich AnrainerInnen über Algenteppiche, die immer größer, häufiger und dauerhafter werden. Toxine aus diesen roten Fluten haben hunderte Meeressäugetiere getötet.
Organismen wie das „Feuergras“, das die Fischer in der Moreton Bay plagt, gibt es seit urdenklichen Zeiten. Sie entstanden aus dem Urschlamm und dominierten schließlich die ansonsten fast völlig unbelebten Urozeane. Mit der Zeit gewannen höhere Lebensformen die Oberhand. Nun stehen sie wieder unter Druck.
Wie anderen WissenschaftlerInnen fiel Jeremy Jackson diese jüngste Verschiebung der biologischen Machtverhältnisse erst spät auf. Er verbrachte einen Großteil seines beruflichen Lebens unter Wasser. Er glaubte an die Widerstandskraft der Meere, an ihre unerschöpfliche Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Dann kam die Hurrikan-Saison von 1980. Ein Wirbelsturm der Kategorie 5 wühlte das Meer vor der Nordküste Jamaikas auf, wo sich Jackson seit den 1960er Jahren mit Korallen beschäftigte. Ein mächtiges Riff aus Acroporen, einer Gattung von Steinkorallen (die „Haystacks“/Heuhaufen), wurde zertrümmert. WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt trafen ein, um den Schaden zu begutachten. In einem gemeinsamen Paper sagten sie vorher, dass sich die Korallen wie schon seit tausenden Jahren rasch erholen würden.
„Wir waren die besten Ökologen, die sich mit dem meiststudierten Korallenriff der Welt befassten, und wir lagen zu 100 Prozent falsch“, erinnerte sich Jackson. Das Korallenriff mit seinen leuchtenden Farben, das eine Fülle von Fischarten ernährt hatte, erholte sich nicht mehr. Für Jackson ist heute klar, dass die jahrelange, unmerkliche Zunahme der Umweltzerstörung drastische Veränderungen bewirkt hat. Mit dem Ausbau der touristischen Infrastruktur in Jamaika wurden immer mehr Abwässer, Düngemittel und andere Nährstoffe ins Meer gespült. Überfischung dezimierte die Fischbestände, die die Algen unter Kontrolle hielten. Höhere Wassertemperaturen förderten das Wachstum von Bakterien und belasteten die Korallen zusätzlich. Heute ist das Riff weitgehend ein Friedhof von Korallenskeletten.
Ähnliche Entwicklungen haben mittlerweile 80 Prozent der Korallen in der Karibik eliminiert, zwei Drittel der Flussmündungsgebiete der USA und drei Viertel der Seetangwälder Kaliforniens zerstört, die früher einmal ein ausgezeichnetes Habitat für Fische waren. „Wir treiben den Ozean in den Beginn der Evolution zurück“, so Jackson düster, „in die Zeit vor einer halben Milliarde Jahren, als die Ozeane von Quallen und Bakterien regiert wurden.“
Vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia: Der 17-Meter-Fischkutter wurde vom Gewicht eines gewaltigen Fangs achtern ins Wasser gedrückt. Die Stahlseile ächzten und knarrten, als ob sie im nächsten Augenblick reißen würden. Grover Simpson hievte das Netz und seinen triefenden Inhalt auf das Hinterdeck. Mit einem Ruck an der Auslöseleine gab der bauchige Sack seine massive Last frei. Etwa eine Tonne Kanonenkugel-Quallen klatschte auf das Deck. Ein penetranter Geruch wie nach Ammoniak erfüllte die Luft. „Das ist der Geruch des Geldes“, grinste Simpson . „Quallen sind heute ein Renner. Sieben Cent das Pfund. Man kann nicht sagen, dass wir schlecht verdienen.“
Selbst essen würde Simpson eine Qualle nie. Aber nach Jahrzehnten der Schleppnetzfischerei sind Garnelen in der Gegend rar geworden. In den Wintermonaten, wenn die Quallen in Schwärmen auftreten, fängt er nun das, was er früher nur als lästiges Zeug betrachtete, das seine Netze verstopfte. Die Rechnung ist einfach: Entweder verbringt er eine Woche damit, den Meeresgrund nach Garnelen abzuschaben und dabei mit Glück 600 US-Dollar zu verdienen. Oder er holt mit seinem Schleppnetz in ein paar Stunden genug Quallen heraus, um seinen Laderaum zu füllen, ist am selben Tag wieder im Hafen und kassiert das Doppelte. Die Quallen werden am Dock in Darien verarbeitet und nach China und Japan exportiert, wo scharfe Quallensalate und -suppen als Delikatesse gelten.
Die Quallenbestände wachsen, weil sie können. Die Fische, die früher mit ihnen um Nahrung konkurrierten, sind wegen der Überfischung selten geworden. Die Meeresschildkröten, die früher auf sie Jagd machten, sind beinahe völlig verschwunden. Und das Plankton, ihr liebstes Futter, wächst exponentiell. Während ihr traditioneller Fang abnimmt, holen Fischer weltweit heute 450.000 Tonnen Quallen aus dem Meer, mehr als doppelt so viel wie vor zehn Jahren.
Für Daniel Pauly, Fischereiexperte der University of British Columbia, ist das ein logischer Schritt in einem Prozess, den er „die Nahrungskette abwärts fischen“ nennt. Zuerst konzentrierten sich die Fischer auf die beliebtesten Arten wie Thunfisch, Schwertfisch, Kabeljau und Zackenbarsch. Als diese Bestände erschöpft waren, wechselten sie auf andere Beute, oft kleiner und weiter unten in der Nahrungskette.
Überfischung gab es zwar schon vor Jahrhunderten, doch nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigte sich der Prozess dramatisch. Industrielle Fangflotten rüsteten sich mit Sonaren, Satellitendaten und Global Positioning-Systemen aus, die ihnen ermöglichten, Fischschwärme zu verfolgen und ihre entlegensten Habitate aufzuspüren. Die Bestände an großen Fischarten haben daher in den letzten 50 Jahren um 90 Prozent abgenommen.
Dieser Rückgang lässt sich auf den Fischmärkten reicher Länder nicht ohne weiteres feststellen. Dort sind die Menschen bereit, hohe Preise für exotische Kost aus weit entfernten Meeren zu bezahlen – Granatbarsche, gefangen vor Neuseeland, oder Schwarzen Seehecht aus den Meeren der Südhalbkugel. Heute sind beide Arten bereits selten.
Auch die Fischzucht fordert ihren Tribut. Um die Zuchtbestände zu füttern, werden Heringe, Sardinen und Sardellen in großen Mengen gefangen, zermahlen und zu Pellets verarbeitet. Dichte Schwärme dieser kleinen Fische bevölkerten früher die Flussmündungsgebiete und Küstengewässer der Erde und verschluckten Plankton wie Wolken silberfarbener Staubsauger. Die Chesaspeake Bay in Maryland, das größte Mündungsgebiet der USA, war früher für ihr klares Wasser bekannt. Es wurde alle drei Tage von Unmengen von Austern gefiltert, deren Riffe sogar als Gefahr für die Schifffahrt galten. Damit ist es schon lange vorbei.
Die Erschöpfung der Fischbestände ermöglicht eine explosive Vermehrung der niedrigsten Lebensformen, sagt Pauley, sie „verwandelt die Ozeane in eine Mikrobensuppe“.
Copyright New Internationalist
Kenneth R. Weiss ist Redakteur der Los Angeles Times, wo dieser Artikel ursprünglich erschien. Es handelt sich um einen redigierten Auszug, der vom New Internationalist mit Genehmigung nachgedruckt wurde.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.