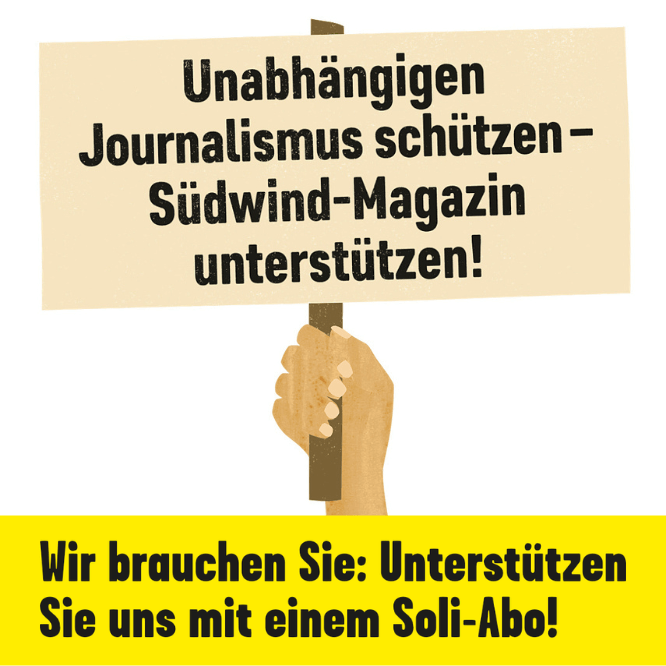Die WanderarbeiterInnen in China sind maßgeblich für den wirtschaftlichen Aufstieg ihres Landes verantwortlich und auch zu einer einflussreichen Kraft in der Weltwirtschaft geworden. Können sie mehr bekommen als die Krümel vom Tisch, den sie selbst reichlich gedeckt haben? Eine Analyse von NI-Redakteur Richard Swift.
2009 erklärte das Time Magazine die jungen WanderarbeiterInnen in China kollektiv zur zweiten „Person des Jahres“ – hinter Ben Bernanke, dem Chef der US-Notenbank. Der Grund: Sie hatten dazu beigetragen, dass die chinesische Wirtschaft um mehr als acht Prozent zulegte, und damit „eine Konjunkturspritze für den Rest der Welt“ geliefert. Der Dank gebührte den „dutzenden Millionen ArbeiterInnen, die ihre Heimat und oft ihre Familien verlassen haben, um in den Fabriken der boomenden chinesischen Küstenstädte zu arbeiten“.
Diese Migration ist ein zwiespältiges Phänomen. Einerseits werden die MigrantInnen begrüßt, andererseits aber abgelehnt. Ihre Arbeitskraft ist willkommen, aber als Menschen sind sie es oft nicht. Sie gelten als laut, übelriechend, lästig, ja sogar kriminell, kurz, man betrachtet sie als „Fremde“, obwohl sie dieselbe Staatsbürgerschaft haben und meist derselben ethnischen Gruppe angehören. Sie leben oft in einer halblegalen Situation, als Unterprivilegierte in einer Welt, in der die Reichen und Mächtigen darauf aus sind, ihre Schwächen zum eigenen Vorteil auszunutzen.
China erlebt derzeit die größte Migrationsbewegung in der Geschichte der Menschheit. Dutzende Millionen junger Menschen lassen die relative Stabilität des ländlichen Lebens hinter sich und strömen in die Freihandelszonen und Industrie-Enklaven, die sich großteils in den Küstenregionen des Landes befinden. Die traditionelle Arbeiterklasse Chinas wurde durch Privatisierung und Firmenzusammenbrüche dezimiert, und die Hauptquelle der Arbeitskräfte für den boomenden Exportsektor sind heute MigrantInnen der ersten und zweiten Generation. Diese jungen Arbeitskräfte sind den Unternehmen lieber als die alten, die noch die soziale Sicherheit und das langsamere Arbeitstempo in den früheren Staatsbetrieben gewohnt sind.
Wie viele Menschen sich tatsächlich in den letzten zehn Jahren auf Wanderschaft begeben haben, lässt sich nicht genau sagen, aber die Schätzungen reichen von 200 bis 300 Millionen. Die letztere Zahl entspricht etwa der Gesamtbevölkerung der USA. Selbst nach offiziellen Angaben verlassen jährlich 20 Millionen Menschen ihre Heimat. Es ist ein gewohntes Bild auf den Bahnhöfen: junge MigrantInnen, die sich mit all ihrem Hab und Gut in Gruppen zusammenkauern, versuchen, etwas zu schlafen zwischen der Busfahrt und der Zugverbindung, die sie ins „Gelobte Land“, nach Shanghai oder in die Sonderwirtschaftszone in Guangdong (im Hinterland von Hongkong) bringen wird.
Das Wunder, das diese MigrantInnen ermöglicht haben, hat das Gesicht der Weltwirtschaft verändert. China ist zur Werkbank der Welt aufgestiegen, und alle wichtigen Indikatoren (Wirtschaftswachstum, Handelsbilanz, Dominanz auf den Anleihenmärkten) belegen eine Verlagerung der wirtschaftlichen Macht von den USA und Europa nach Asien, mit China an der Spitze. Aber diese ArbeiterInnen haben kaum von diesem Prozess profitiert, und sie waren mit Sicherheit nicht seine Hauptnutznießer.
Chinas Elite hat sich zwar dem Kapitalismus und der Privatinitiative verschrieben, doch die Welt am anderen Ende der sozialen Leiter ist weiterhin von Autokratie und Willkür dominiert. Es gibt kein besseres Beispiel dafür als das Hukou-System der staatlichen Haushaltsregistrierung aus der maoistischen Ära, das trotz einiger Reformen nach wie vor bestimmt, wer wo leben darf. Millionen chinesischer MigrantInnen leben aus diesem Grund in permanenter Unsicherheit, was von ihren ArbeitgeberInnen und oft auch von korrupten lokalen BeamtInnen und PolizistInnen ausgenutzt wird.
Unternehmen ziehen oft die Identitätsausweise und Pässe von ArbeiterInnen ein, um sie davon abzuhalten, davonzulaufen oder zu hohe Ansprüche zu stellen. Kinder, die in die Städte mitgenommen wurden, werden von den Eltern getrennt und mehr schlecht als recht in „illegalen“ Schulen unterrichtet, wofür gesondert zu bezahlen ist. Es ist billiger, sie bei den Großeltern oder anderen Familienangehörigen zurückzulassen, wo sie kostenlose Dorfschulen besuchen können. Ehepartner sehen sich oft monatelang nicht, da sie in verschiedenen Regionen des Landes arbeiten.
In diesem gesetzlichen Graubereich sind ArbeiterInnen mit zahlreichen Missständen und Arbeitsrechtsverletzungen konfrontiert, darunter niedrige Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Zwang zur Steigerung des Arbeitstempos, Nichtzahlung von Löhnen (manchmal für Monate), Angst vor Polizeirazzien, Polizeihaft, gegen die kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, zwangsweise Abschiebung in ihre Heimatdörfer und das Dauerproblem der Bestechungsgelder, die bezahlt werden müssen.
Über diese Missstände ist in einigen Fällen nun auch in chinesischen Medien zu lesen, da die JournalistInnen zunehmend bereit sind, an die Grenzen des Erlaubten zu gehen. Sogar Berichte über regelrechte Sklavenarbeit sind darunter: Menschen wurden aus ländlichen Gebieten entführt und zur Arbeit in Ziegelfabriken in Shanxi gezwungen. Bei einer von diesen Berichten ausgelösten offiziellen Untersuchung kam etwa heraus, dass mehr als 53.000 Menschen illegal beschäftigt worden waren. Li Datong, früherer Mitarbeiter der China Youth Daily: „Die Untersuchung deckte auf, dass es Entführungen, Beschränkungen der persönlichen Freiheit, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Missbräuche und sogar Ermordungen von Arbeitern gab.“
Der rasante wirtschaftliche Aufschwung Chinas in den letzten beiden Jahrzehnten war das Resultat eines Kurswechsels unter Deng Xiaoping in der Ära nach Mao. Deng, der in den 1980er Jahren die Devise „Reich werden ist ruhmvoll“ ausgegeben haben soll, öffnete 1992 bei seiner „Reise in den Süden“ mit seiner Ermunterung zu weiteren Reformschritten die Tore für die wirtschaftliche Expansion (das Bruttoinlandsprodukt vervierfachte sich zwischen 1989 und 2004), aber auch für Ausbeutung, Ungleichheit und Korruption. Die Ausrichtung auf den Weltmarkt bedeutete eine Abkehr vom traditionellen maoistischen Ziel der Autarkie zugunsten von Direktinvestitionen aus dem Ausland (vor allem der chinesischen Diaspora, insbesondere in Hongkong und Taiwan), um das Potenzial zu nutzen, das in Form des beinahe unerschöpflichen Angebots billiger Arbeitskräfte gegeben war.
Was dieser Wandel nicht brachte, war eine politische Öffnung und eine Erweiterung der demokratischen Rechte (inklusive des Rechts zur Bildung unabhängiger Gewerkschaften), worauf viele gehofft hatten. Das wurde in der schicksalhaften Nacht des 4. Juni 1989 klar, als führende Parteimitglieder aus dem Kreis um Deng Xiaoping die Armee nach Peking einmarschieren ließen, um die StudentInnenbewegung zu unterdrücken, die mit der Besetzung des Tiananmen-Platzes einen demokratischen Wandel erzwingen wollten. Mehr als 1.000 Menschen (die meisten davon EinwohnerInnen der Hauptstadt, die mit den StudentInnen solidarisch waren), wurden entweder erschossen oder starben unter den Rädern der Armeefahrzeuge. Tausende weitere wurden verletzt oder verhaftet. Persönlichkeiten wie Zhao Ziyang, die als Befürworter einer politischen Liberalisierung galten, wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Seither wurde Kritik am System als Ganzen (im Unterschied zur Kritik an einzelnen Missständen) nicht mehr toleriert.
In dieser schrecklichen Nacht verlor die Kommunistische Partei einen Großteil ihres Prestiges und ihrer Beliebtheit. Deng hatte darauf gewettet, dass das Verlangen nach Reformen durch wirtschaftlichen Wohlstand neutralisiert werden könnte. Die Wette ging zum Teil auf, zumindest bei den Millionen modebewusster (aber unpolitischer) KonsumentInnen, die heute die städtischen Mittelschichten in Shanghai und Guangdong bilden. Aber ob das auch für die WanderarbeiterInnen gilt, den Motor des chinesischen Wirtschaftswunders, ist eine andere Frage. Der Autoritarismus, mit dem das System auf der obersten Ebene verteidigt wird, pflanzt sich nach unten fort, in Form repressiver lokaler Provinzverwaltungen und despotischer Managementpraktiken in den meisten Unternehmen. Die auf allen Ebenen anzutreffende Willkür und Korruption ist der politischen Führung nicht nur peinlich; es wird ihr zusehends klar, dass die systematische Misshandlung von ArbeiterInnen das gesamte System gefährdet.
Das Time Magazine hat tatsächlich Grund, den WanderarbeiterInnen dankbar zu sein. Das chinesische Wirtschaftsmodell beruht auf ArbeiterInnen, die zwölf Stunden täglich für gerade 2,7 Prozent des entsprechenden Lohns in den USA jene Produkte erzeugen, die im lokalen Walmart-Supermarkt oder HighEnd-Computergeschäft verkauft werden. Diese Produkte sind nicht nur notwendig, um den schuldenfinanzierten US-amerikanischen Lebensstil zu ermöglichen; die Profite werden zudem von chinesischen Banken in US-Staatsanleihen investiert und tragen dazu bei, die bereits am absteigenden Ast befindliche Supermacht über Wasser zu halten.
Chinas Rolle in der Welt, so der chinesische Soziologe Ho-fung Hung in einer provokanten Formulierung, sei die eines „Oberdieners“ der USA. Seiner Ansicht nach existiert eine Koalition zwischen den Exportunternehmen und ihren politischen Verbündeten in der Kommunistischen Partei Chinas und den Konzernen, die den Einzelhandel in den USA (und im Rest der Welt) dominieren. Dabei hätte sich die chinesische Politik finanziell an die Macht des US-Imperiums angekoppelt, gewährleiste die Leistbarkeit der aufgeblasenen Militärausgaben der USA und damit die Aufrechterhaltung der herrschenden Weltordnung. Hungs These einer „kriminellen Partnerschaft“ ist das exakte Gegenteil der üblicheren Ansicht, der Aufstieg Chinas bedrohe die Vorherrschaft der USA.
Die Kosten dieser Strategie werden vom Großteil der ArbeiterInnen und BäuerInnen Chinas getragen, in Gestalt einer „Unterkonsumptionskrise“. Unter solchen prekären Bedingungen leben alle, die am Land geblieben sind; die WanderarbeiterInnen, auch wenn sie die ländliche Armut gegen eine lukrativere, aber trotzdem marginale Existenz in der Produktion von Exportgütern getauscht haben, die sie sich selbst nicht leisten können, und schließlich die älteren ArbeiterInnen, die im Rahmen der „Gesundschrumpfung“ der ineffizienten Staatsbetriebe entlassen wurden. Die letztere Gruppe umfasste allein in den 1990er Jahren 45 bis 60 Millionen Menschen. Ihre Jobs waren die letzten, die von der Politik der „Eisernen Reisschale“ geschützt worden waren, dem Ausgleich bescheidener Löhne durch großzügige Sozialleistungen und Pensionen. Die Privatisierung im Zuge der Marktreformen unter Deng machte dem ein Ende: Die Betriebe wurden oft in den Konkurs getrieben und filetiert, wobei sich das eigene Management die Rosinen aus dem Kuchen pickte.
Es waren die von diesen Massenentlassungen betroffenen ArbeiterInnen, die für die ersten sozialen Unruhen in China verantwortlich waren. Sie konzentrierten sich auf die traditionellen Industrieregionen im Nordosten wie etwa in Liaoyang (Schwerindustrie) und Daquing (Ölindustrie). Lokaler Unmut über die Vernichtung von Arbeitsplätzen eskalierte rasch zu Massenprotesten gegen korrupte lokale Parteifunktionäre. In den 1990er Jahren, als gerade die Devise ausgegeben worden war, möglichst rasch reich zu werden, stieg die Zahl der Arbeitskämpfe nach offiziellen Angaben von 8.150 (1992) auf mehr als 120.000 (1999). Es kam zu Blockaden von Autobahnen und Eisenbahnlinien, ab und zu sogar zu gewaltsamen Konfrontationen zwischen Streikenden und bewaffneten Milizen.
Heute haben sich die Arbeitskämpfe in das Perlfluss-Delta im Süden Chinas und andere Enklaven der Exportindustrie verlagert, wo sich die WanderarbeiterInnen zu organisieren beginnen. Es geht auch nicht mehr um die Verteidigung der lebenslangen Arbeitsplatzgarantie unter dem kommunistischen System, sondern um die drakonischen Arbeitsbedingungen und die niedrigen und oft zu spät bezahlten Löhne in der privaten Exportindustrie. Streiks sind zwar in China seit Anfang der 1980er Jahre illegal; das kümmerte die Protestierenden aber nicht. Auf die erste Streikwelle, die 2004 die Region am Perlfluss erfasste, reagierte die westliche Welt besorgt und alarmiert, wie man den weltweiten Finanzmedien entnehmen konnte. Seither kam die Gegend nicht mehr zur Ruhe. Die Palette der Widerstandsaktionen reicht von Arbeitsniederlegungen über Sabotage in der Autoindustrie bis zu einer Reihe von Selbstmorden frustrierter ArbeiterInnen, die derzeit dem Image des riesigen Elektronikkonzerns Foxconn einigen Schaden zufügen (siehe Artikel S. 32).
Die letzten Arbeitskämpfe im Sommer 2010 begannen mit einem Streik von mehr als 1.000 ArbeiterInnen in einem Honda-Werk in Foshan (siehe SWM 9/2010, Seite 12 ff.). Es war nicht bloß ein Kampf gegen die Leitung des Unternehmens, sondern auch gegen die eigene Gewerkschaft, keine Seltenheit in China. Die Gewerkschaft organisierte sogar physische Angriffe auf die Streikenden. Aber die ArbeiterInnen hielten durch, mehr als zwei Wochen lang. Ihre Erfolge waren spektakulär – nicht nur eine Lohnerhöhung um 24 bis 33 Prozent, sondern auch eine demokratische Reform ihrer Gewerkschaft. Die jüngere Generation der WanderarbeiterInnen zeigt sich weit kämpferischer als ihre Eltern und nutzt auch soziale Medien zur Koordinierung von Protestaktionen.
Die Zentralregierung in Peking beginnt die sozialen und politischen Kosten des Wirtschaftswunders zu begreifen und lässt eine gewisse Bereitschaft erkennen, ihre Begeisterung für den Markt zu korrigieren. Die beiden vielleicht wichtigsten Kursänderungen sind die Versuche, die verzweifelte Lage der armen Landbevölkerung zu verbessern (Politik des „sozialistischen ländlichen Raums“), sowie ein neues Arbeitsvertragsrecht, das (zumindest theoretisch) Mindestrechte wie etwa das Recht auf rechtzeitige Bezahlung garantiert. Westliche Unternehmen versuchen, sich weiterhin als bloße Käufer chinesischer Produkte oder Aktionäre chinesischer Firmen darzustellen und jede Verantwortung für drakonische Arbeitsbedingungen von sich zu weisen. Aber gerade das Arbeitsvertragsrecht wurde aufgrund von Interventionen europäischer und US-amerikanischer Unternehmensverbände verwässert. Wie sich gezeigt hat, können selbst geringfügige Reformen auf lokaler Ebene einfach ausgehebelt werden, da es keine demokratischen Rechte gibt, die ihre Umsetzung sicherstellen könnten.
Welche Taktik sollten die ArbeiterInnen in China verfolgen? Für Han Dongfang, einen altgedienten Aktivisten und Gründer des China Labour Bulletin in Hongkong, ist die bisherige Geschichte Chinas eine Abfolge gewaltsamer Brüche und Revolten. Er stellt sich zwar nie gegen direkte Aktionen von ArbeiterInnen, befürwortet aber den Aufbau einer Verhandlungskultur auf gesetzlicher Basis, um durchsetzbare Rechte einzuführen. Wahrscheinlich wird die neue Arbeiterbewegung nicht nur Stärke brauchen, sondern auch listig sein müssen, um aus dem „Graubereich“ zu entkommen und sich einen gerechten Anteil an dem „Wirtschaftswunder“ zu sichern, das sie schließlich selbst geschaffen haben.
Copyright New Internationalist
Richard Swift ist ehemaliger Redakteur des New Internationalist und Autor des Buches „The No-Nonsens Guide to Democracy“.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.