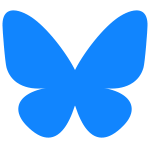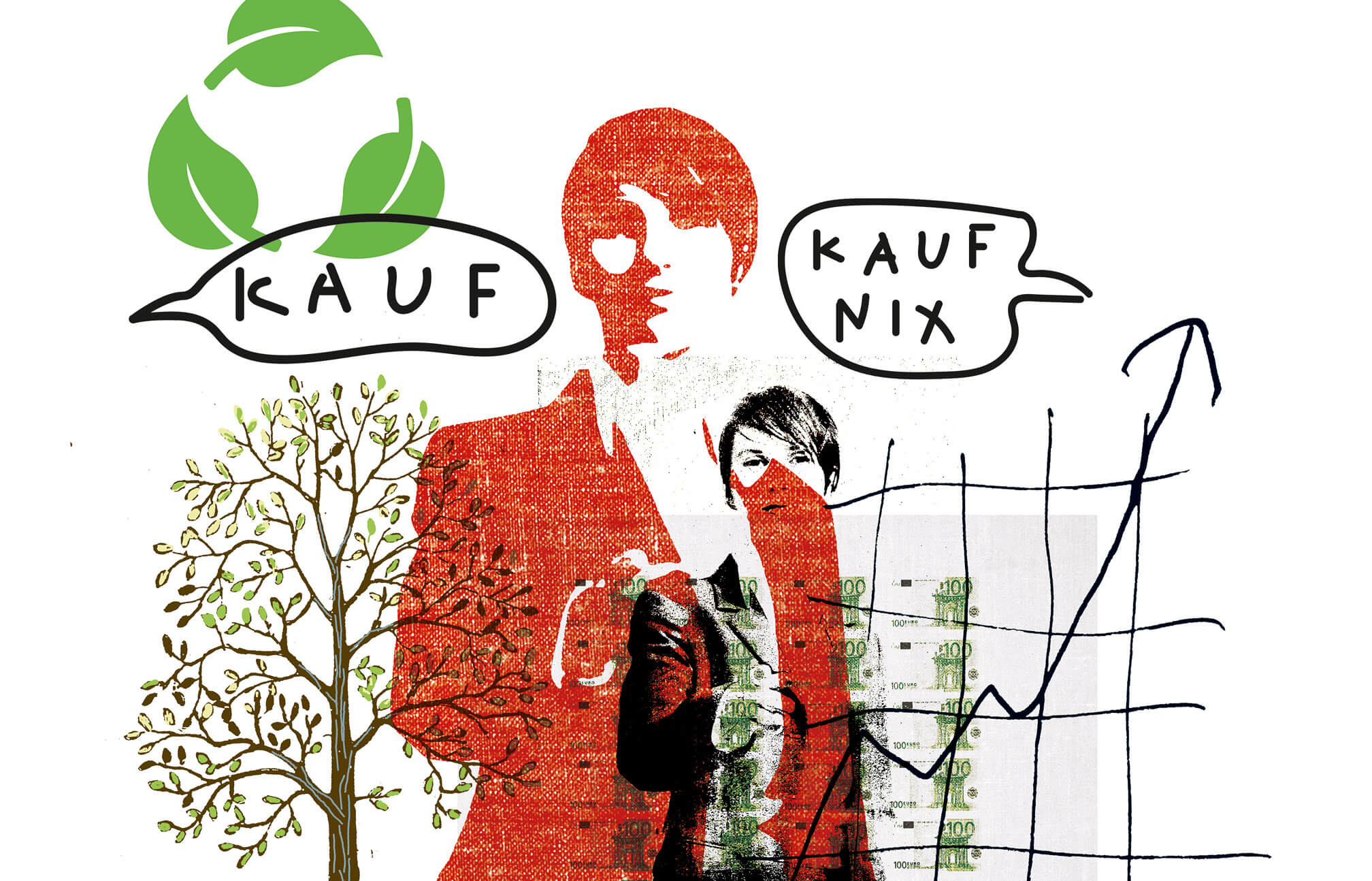Weltbank als Teil des Armutsproblems

Expert*innen kritisieren an der Weltbank, dass sie globale Ungerechtigkeiten als Ursache von Armut ausblendet.
Erstmals seit 20 Jahren steigt die Zahl jener, die in Armut leben, wieder an. Ein Bericht der Weltbank, der im Herbst 2021 aktualisiert wurde, weist 100 Millionen Menschen aus, die aufgrund der Pandemie unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Laut Schätzungen müssen derzeit weltweit über 700 Millionen Menschen mit weniger als 1,90 US-Dollar (1,70 Euro) am Tag auskommen, dem Schwellenwert, den die multinationale Entwicklungsbank als Armutsgrenze definiert.
Aber lässt sich mit diesem Schwellenwert als Armutsindikator das Ausmaß tatsächlich greifen? Roberto Bissio, Koordinator des internationalen Netzwerks „Social Watch“, das die Einhaltung von internationalen Abkommen beobachtet, bewertet in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) die von der Weltbank als Armutsgrenze definierten 1,90 US-Dollar am Tag als zu niedrig. Außerdem kritisiert er die Annahme der Weltbank, dass der Wirtschaftsaufschwung 2021 allen zugutekommen und dadurch der durch die Covid-Krise 2020 ausgelöste „Armuts-Tsunami“ abgefedert werde.
Bissio betont: „Damit ignoriert die Weltbank das Fazit des World Inequality Report 2022, der darlegt, wie Ungerechtigkeiten bzw. Ungleichheiten vor allem im Globalen Süden verstärkt wurden, wo Staaten kaum Ressourcen haben, um Notfallmaßnahmen zur sozialen Absicherung einzuführen.“
Ziele verfehlt. Bissio stimmt der Weltbank allerdings zu, dass das nachhaltige UN-Entwicklungsziel SDG 1 zur Reduzierung der globalen Armut bis 2030 nicht erreicht werde. Ebenso wenig sei das für das SDG 10 zur Verringerung von Ungleichheiten zu erwarten. Es sei aber beschämend, wie ignoriert würde, „dass Maßnahmen zur Privatisierung und Deregulierung, die von der Weltbank unterstützt wurden, diese Ungleichheiten verschärfen“.
Laut Bissio ist jene Institution, die Armutsverringerung als ihre Hauptaufgabe angibt, Teil des Problems, nicht der Lösung.
Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres verweist immer wieder auf die globale Herausforderungen, die die Pandemie deutlich machte – etwa strukturelle Ungerechtigkeiten, unzureichende Gesundheitsvorsorge und das Fehlen universeller sozialer Absicherung –, sowie den hohen Preis, den die Gesellschaften als Folge zu zahlen haben.
Historische Ungerechtigkeiten. Vincente Paolo Yu, leitender Rechtsberater der Entwicklungsorganisation „Third World Network“, zählte gegenüber IPS jene „aktuellen historischen Ungerechtigkeiten“ auf, die „auf dem Rücken des Globalen Südens im Namen der westlichen Zivilisation und der Globalisierung begangen wurden“. Dazu gehören für ihn globale Armut, Entwicklungsgefälle zwischen und innerhalb von Staaten, Klimakrise, Verlust der Biodiversität und Maßnahmen gegen die Pandemie, von denen nicht alle Menschen gleich profitierten.
Globale Armut und Ungerechtigkeiten existierten nicht, weil die Menschen nicht in ihrer eigenen Heimat hart arbeiten, betont Yu, sondern aufgrund der Art und Weise, wie das globale Wirtschafts- und Handelssystem aufgebaut sei. Dieses mache es für arme Menschen und Länder schwieriger, aus der Armut herauszukommen, argumentierte er. „Wir sollten nicht einfach wegschauen und nach Spenden rufen. Wir müssen Taten setzen, die Mut und Überzeugung zeigen, die Ungerechtigkeit zu korrigieren und sie zu beseitigen“, sagt Yu.
Übersetzung: Barbara Ottawa
Thalif Deen, bei IPS Chef des UN-Büros, berichtet seit den späten 1970er Jahren über die Vereinten Nationen und ihre Konferenzen.
Barbara Ottawa ist freie Journalistin und lebt in Wien.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.