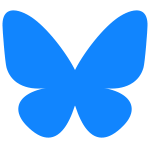Wen die Banane krank macht

Bananen aus Ecuador landen täglich in europäischen Supermärkten – oft auf Kosten der Gesundheit der Menschen, die sie ernten. Gewerkschafter:innen schlagen Alarm über giftige Chemikalien, fehlenden Arbeitsschutz und fordern endlich Konsequenzen.
„Es ist eine Riesenindustrie, in der viel Geld steckt. Viele wollen nicht hören, dass diese Probleme hervorbringt“, sagt Diana Montoya Ramos im Gespräch mit dem Südwind-Magazin in Wien. Sie hat für ihre Arbeit in der ecuadorianischen Gewerkschaft schon mehrmals Morddrohungen erhalten. Mit dem Juristen José Barahona von der Gewerkschaft ASTAC, die Landarbeiter:innen und Bäuer:innen vertritt, reist Montoya Ramos im Herbst durch Europa, um über den Chemiekalieneinsatz auf den Plantagen zu berichten.
Das 18-Millionen-Einwohner:innen-Land an der Nordwestküste Südamerikas ist der größte Bananenexporteur der Welt. Rund 250.000 Arbeitsplätze hängen direkt von diesem Sektor ab. Die EU ist der größte Abnehmer. Gemeinsam mit der Anden-Universität Simón Bolívar untersuchte die Gewerkschaft die gesundheitlichen Auswirkungen des Fungizids Mancozeb auf 103 Arbeiter:innen von 27 Plantagen. ASTAC wies Rückstände davon in Urinproben von elf Personen nach. Viele klagen über Atembeschwerden, Kopfschmerzen und Hautprobleme. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit kann Mancozeb Hormone verändern und auch zu Schilddrüsentumoren führen. 2020 beschloss die EU-Kommission daher die Zulassung von Mancozeb nicht zu verlängern. In Ecuador ist es noch frei im Verkauf erhältlich. Der Rechtsanwalt José Barahona arbeitet nun an einer Klage für ein Verbot des giftigen Pflanzenschutzmittels.
Präsident ist Bananenproduzent
In einer weiteren Studie von ASTAC mit fast 1.600 Befragten, die auf den Plantagen der fünf größten Unternehmen im Sektor arbeiten, gaben nur neun Prozent an, dass sie wissen, welche Chemikalien an ihrem Arbeitsplatz verwendet werden. Immer wieder kommt es vor, dass Arbeiter:innen auf der Plantage sind, während vom Flugzeug oder von Drohnen aus Gift gesprüht wird, erklärt die Gewerkschafterin Montoya Ramos. „Oft gibt es nur eine Schutzmaske für das ganze Monat“, sagt sie und fügt hinzu: „Viele Arbeiter:innen gehen in der gleichen Kleidung arbeiten, in der sie zu Hause am Tisch sitzen.“ Auch Familienmitgliedern, die nicht im Bananensektor arbeiten sind betroffen. Die Häuser der Arbeiter:innen sind meist in der Nähe der Plantagen. Zwar ist eine gesetzliche Schutzzone von 200 Meter vorgesehen, in der nicht gebaut werden soll, doch derzeit wird in Ecuador eine Reduktion auf 30 Meter diskutiert.
Ein zentraler Akteur ist Daniel Noboa, seit zwei Jahren Präsident der Republik. Auf den Plantagen von Noboa Trading, einem von seinem Vater aufgebauten Bananenvermarkter, arbeiten fast 3.000 Personen – 341 von ihnen nahmen ebenfalls teil an der großen Studie von ASTAC. Das Ergebnis: Nur 17 Prozent hatten eine Kopie ihres Arbeitsvertrages. Mehr als die Hälfte gab an keine Sozialversicherung zu haben. Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit, stünden sie ohne Unterstützung da. Das ist keine Ausnahme, wie Barahona erklärt: „Alle Arbeitsrechte werden in größerem oder kleinerem Umfang verletzt. Überstunden werden nicht ausbezahlt. Frauen bekommen weniger Lohn als Männer.“
Arbeiter:innen in Kontrollen miteinbeziehen
Um diese Probleme flächendeckend zu lösen, müssen die Arbeiter:innen in den Prozess der Zertifizierung eingebunden werden, ist Montoya Ramos überzeugt. Diesen Ansatz verfolge das Fair Food-Programm, das schon in den USA, Chile und Südafrika erprobt wurde. Arbeiter:innen bekommen als Kontrolleur:innen Verantwortung und können ihre eigenen Rechte sicherstellen. Die Gewerkschafterin kritisiert Zertifizierungen, wie die Rainforest Alliance. Denn diese verlangen Geld von den Unternehmen für die Gütesiegel, aber die Kosten tragen am Ende die Kund:innen. „Die Verantwortung kann nicht bei einer Zertifizierungsstelle liegen, die sich nicht dafür interessiert, ob Arbeitsrechte eingehalten werden“, so Montoya Ramos.
Und auch die Konsument:innen sollen in den Prozess eingebunden werden, denn: „wenn Menschen Bananen essen, die gespritzt wurden, essen sie die Pestizide mit.“ ASTAC ruft dazu auf, nicht nur Bio-Zertifikate zu achten, sondern auch ethische Standards überprüfen.
Nicht zuletzt appelliert ASTAC gemeinsam mit Südwind an die EU und die österreichische Regierung. Sie dürften nicht zuzulassen, dass das geplante EU-Lieferkettengesetz geschwächt werde. „Es ist so wichtig, dass dieses Gesetz beibehalten wird, weil den Unternehmen, damit klargemacht wird, welche Verantwortung sie für ihre Arbeiter:innen haben“, sagt Montoya Ramos.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.