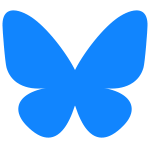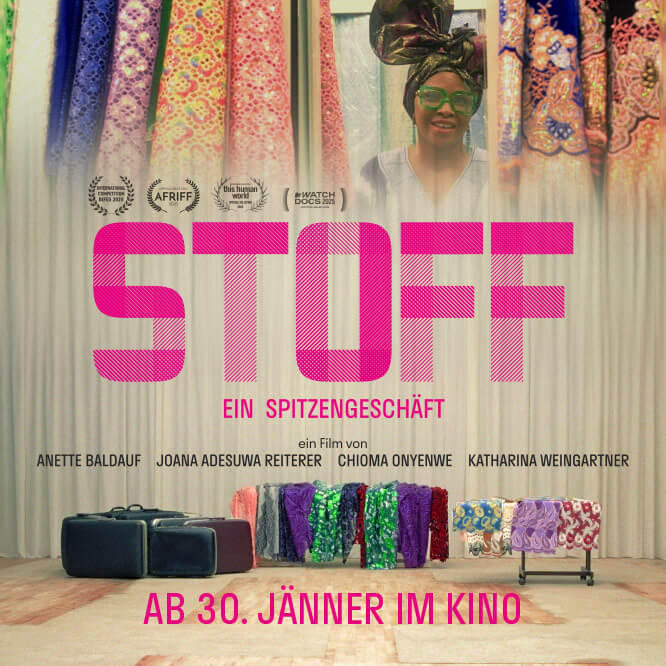Chinas Aufstieg zur Supermacht

Warum Xi Jinping bei der größten Militärparade der chinesischen Geschichte auf maximale Abschreckung setzt, und wie Kim Jong-Un und Wladimir Putin ins Bild passten, erklärt die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik.
China hat sich im September anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien mit der größten Militärparade seiner Geschichte auf der Weltbühne in Szene gesetzt. Was war die Botschaft dieser Inszenierung von Chinas Staatspräsident Xi Jinping mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und Kremlchef Wladimir Putin?
In China wird gerne diplomatisch gesagt: „Wir sind keine Supermacht, wir befinden uns noch auf dem Weg dorthin“. Aber die Zeiten, in denen China mit seiner Stärke hinter dem Busch gehalten hat, wie das unter Deng Xiaoping der Fall war, der bis 1997 regierte, scheinen vorbei zu sein. China hat mit dieser Parade gezeigt, dass es eine Weltmacht ist. Aber, dass Xi das flankiert von den anderen beiden Autokraten getan hat, ist wohl eher dem Einsatz Putins geschuldet. Dieser ist im Augenblick enger mit Kim verbunden als Xi, weil Nordkorea Soldaten und Munition zur Unterstützung des Kriegs gegen die Ukraine nach Russland schickt. Daher wird er sich dafür eingesetzt haben, dass sich Kim in Peking zeigen durfte.
US-Präsident Donald Trump hat aufgrund dieses Auftritts eine Verschwörung gegen die USA gewittert. Denken Sie das Ganze war tatsächlich als Provokation gedacht genau 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs?
Vorsicht, hier tappen Sie in die Falle. Im Vorfeld der Parade wurde in China die Erzählung, wonach die USA den größten Beitrag zum Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg geleistet hätten, von keiner Seite abgelehnt. Man ist hier sehr zurückhaltend. Putin hat vor Medien betont, dass während seines Aufenthalts in China kein einziges negatives Wort gegenüber den USA gefallen ist. Diese Haltung ist sowohl im Interesse Putins als auch Xis. Putin möchte die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA verbessern, weil er damit seine Abhängigkeit von China verringern kann. Für Xi ist das Thema USA innenpolitisch schwierig. Es gibt Kräfte innerhalb der kommunistischen Partei, die seine Außenpolitik, die sehr auf Russland ausgerichtet ist, infrage stellen. Sie sehen China ökonomisch unter Druck, weil der Handel mit den USA – nicht zuletzt aufgrund der neuen Zölle – auf ein Minimum reduziert ist, und drängen daher auf eine freundlichere Politik gegenüber Trump.
Aber wie passt das zusammen? Auf der einen Seite will man den US nicht auf die Füße steigen, auf der anderen Seite eine Militärparade mit Kim und Putin?
Mit dem breiten Aufgebot an Waffen richtete man sich an Taiwan und damit auch an die USA. Laut den taiwanesischen Militäranalyst:innen zeigen die dort vorgeführten Waffen, dass der von China beanspruchte Inselstaat dem chinesischen Arsenal militärisch nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und auch die USA könnten mit den Mitteln, die sie bisher für den Fall eines chinesischen Angriffs auf Taiwan vorgesehen hatten, nicht mehr viel ausrichten. Ein US-Flugzeugträgerverband könnte nur noch jenseits der sogenannten Zweiten Inselkette (umfasst u. a. Guam, Palau und Mikronesien, Anm. d. Red.) operieren, weil er sonst sofort beschossen werden würde. Zudem hat China Waffen gezeigt, die mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können und sogar das amerikanische Festland erreichen könnten. Es war also eine Parade der maximalen Abschreckung. In der Rhetorik blieb man diplomatisch, aber durch die Zurschaustellung dieser Waffen wurde Macht demonstriert.
Ein paar Tage vor der Parade war das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) mit Ländern wie Russland, Indien, Iran und Pakistan. Welche Rolle spielt die SCO für China und warum hat das Treffen genau jetzt stattgefunden?
Das SCO-Treffen und die Militärparade sollten die Verbindung von Ökonomie und Militär deutlich machen. Auf der SCO-Konferenz wurde auf Vorschlag Chinas eine neue Bank für Entwicklungszusammenarbeit gegründet. Damit demonstrierte China seine wirtschaftliche Macht und zeigt, dass sich Länder, die dringend Geld brauchen, an China wenden können. Es signalisierte so auch, dass es keinen Krieg mit den USA anstrebt, sondern seinen ökonomischen Einfluss in der Region und im Globalen Süden vergrößern will. Früher galt die Prämisse, dass man mit möglichst vielen Staaten der Welt gute Beziehungen haben müsse, um ökonomisch erfolgreich zu sein. China hat jetzt festgestellt, dass diese Politik der wirtschaftlichen Dominanz allein nicht funktioniert, wenn man keine militärische Stärke zeigt, um die anderen abzuschrecken. Gleichzeitig demonstriert die Volksrepublik, dass sie genug Geld hat, um überall auf der Welt ökonomischen Einfluss geltend zu machen. Es ist wichtig, beides zusammen zu denken.
Die Bevölkerung in China wird älter und könnte sich bis zum Ende des Jahrhunderts sogar halbieren. Welche Rolle spielt der demographische Wandel für den Aufstieg zu einer militärischen Supermacht?
Das ist ein ganz wesentliches Hindernis für die Kampfbereitschaft in China. Sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen, müssten viele Familien ihren einzigen Sohn in den Krieg schicken. Und wenn der einzige Sohn im Krieg fällt, dann ist nach chinesischer Vorstellung die Familie ausgestorben. Insofern ist diese Abschreckungslogik, über die wir gesprochen haben, auch eine Konsequenz dieser demographischen Situation. Man zeigt, dass man über Waffen verfügt. Diese Waffen werden aber überwiegend so eingesetzt, dass sie aus der Ferne bedient werden, damit die Soldaten nicht unmittelbar auf dem Schlachtfeld sein müssen. China zeigt, dass es mit damit ein Maximum an Zerstörung erreichen kann, zieht es aber vor, über den ökonomischen, technologischen und wissenschaftlichen Wettbewerb zu einer anerkannten Weltmacht aufzusteigen.
Interview: Sebastian Rosenauer

Susanne Weigelin-Schwiedrzik hat Sinologie, Japanologie und Politikwissenschaften studiert. Von 2002 bis 2020 war sie Professorin für Sinologie an der Universität Wien. In ihrem Buch „China und die Neuordnung der Welt“, 2023 im Brandstätter Verlag erschienen, widmet sie sich der chinesischen Außenpolitik und den geopolitischen Verschiebungen des 21. Jahrhunderts.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.