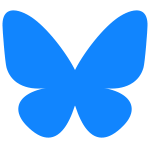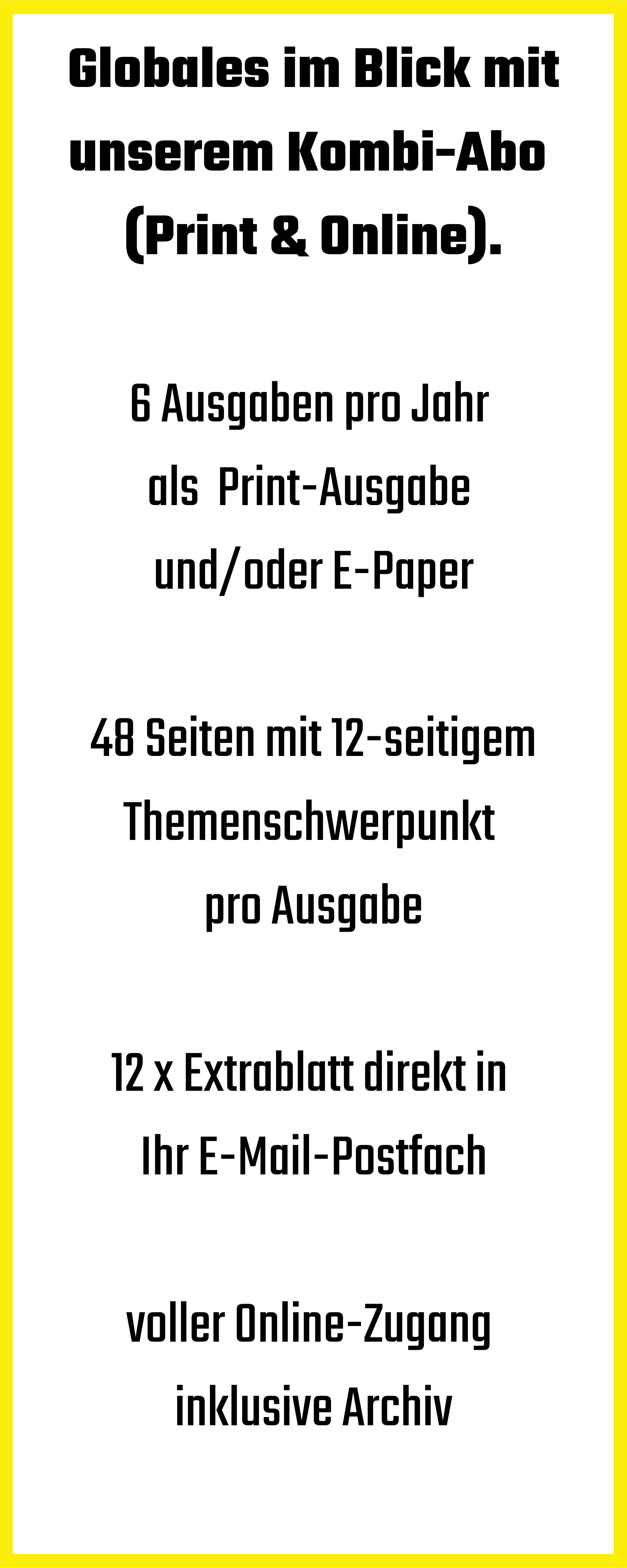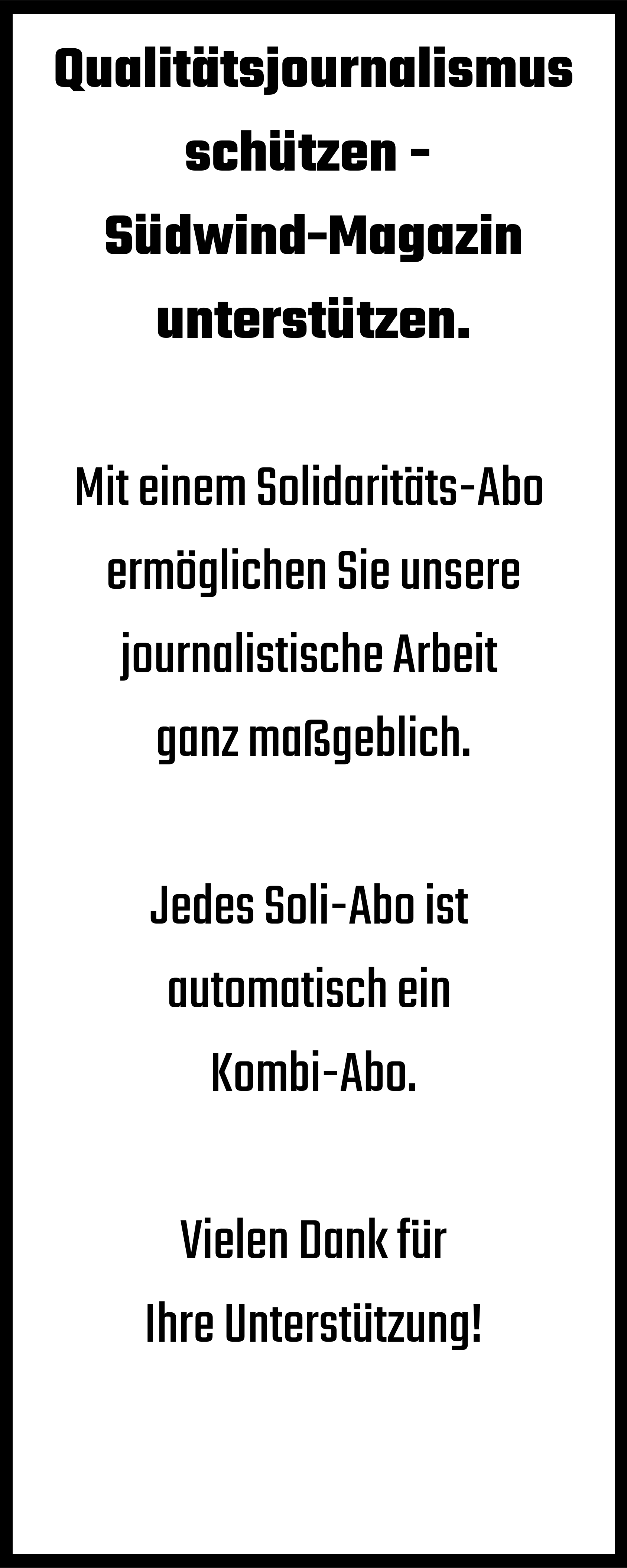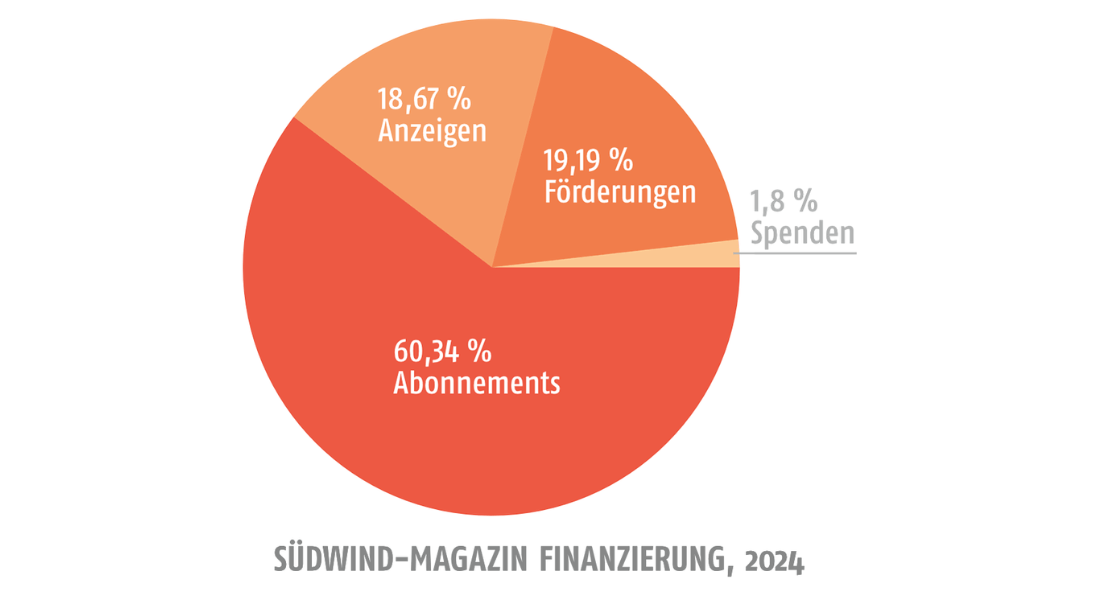Allein in der Wüste

Sonne, Sand und Besatzung. Während Marokko die besetzte Westsahara als Urlaubsziel anpreist und Rohstoffe ausbeutet, kämpfen die Sahrauis für Selbstbestimmung und Wahrung der Menschenrechte in ihrem Land.
Marokko wirbt für ein neues Reiseziel, „dort wo sich Wüste und Meer umarmen“. Flüge einer irischen Billig-Airline machen es möglich. Von Madrid geht es nach Dakhla, einer Stadt an der afrikanischen Atlantikküste südlich der Kanarischen Inseln. Weiße Dünen, Dracheninsel, Kamele und Kitesurfspots locken. Die Hotels sind günstig. Drei Nächte mit Flug kosten weniger als 200 Euro. Das Ganze hat nur einen Haken: Dakhla gehört völkerrechtlich gesehen gar nicht zu Marokko. Es liegt in der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara, die Marokko seit 1975 besetzt hält.
„Wir Sahrauis machen nur noch etwa 15 Prozent der Bevölkerung aus“, sagt die Menschenrechtsaktivistin Djimi Elghalia gegenüber dem Südwind-Magazin. Das sind rund 90.000 Menschen. Der Großteil der insgesamt 600.000 Einwohner:innen dieses Landstriches, der halb so groß wie Spanien ist, sind zugewanderte Marokkaner:innen. Weitere 175.000 Sahrauis leben in Camps in der Wüste im benachbarten Algerien. Sie flohen vor rund 50 Jahren vor marokkanischen Angriffen, bei denen unter anderem Napalmbomben eingesetzt wurden.
Aus dem Blick. Marokko regiert in den eroberten Gebieten seither mit eiserner Hand. „Wer gegen die Besatzung ist, wird verfolgt“, so die 63-jährige Elghalia. Sie lebt in der Hauptstadt Westsaharas, in El Aaiún. Drei Mal wurde sie verschleppt und gefoltert, galt als verschwunden, bis das marokkanische Militär sie wieder frei ließ. Damit ist sie nicht allein. Bis heute werden Gegner:innen der Besatzung verfolgt, ein-gesperrt und misshandelt.
„Und das alles weitgehend unter Ausschluss internationaler Beobachter:innen“, sagt Elghalia.
Seit 2014 sind 317 Vertreter:innen von internationalen Menschenrechtsorganisationen, Solidaritätsgruppen, Pressevertreter:innen und Politiker:innen ausgewiesen worden. Zuletzt eine Gruppe von Journalist:innen und EU-Abgeordneten.
Elghalia spricht von „Apartheid“. Nur wer sich offen zu Marokko bekenne, hätte Aussicht auf Arbeit. Viele junge Sahrauis verlassen deshalb ihre Heimat und setzen in lebensgefährlichen Überfahrten gemeinsam mit Geflüchteten aus Subsahara-Afrika von der Küste Westsaharas auf die Kanaren über. Und auch in den sahrauischen Flüchtlingscamps in Algerien gehe es der Jugend nicht gut. Elghalia: „Viele studieren in Algerien, Kuba oder Spanien. Wenn sie dann als Ärzt:innen oder Ingenieur:innen zurückkehren, gibt es keine Arbeit für sie.“
Gebrochene Versprechen. Die Verzweiflung wächst. „Wir haben den Glauben an die Vereinten Nationen verloren“, sagt sie. Der Grund: 1991 einigten sich Marokko und die sahrauische Befreiungsfront Polisario auf einen Waffenstillstand. Die Frente Polisario, die in Algerien eine Exilregierung der von ihr 1976 ausgerufenen Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) unterhält, kontrolliert 20 Prozent Westsaharas. Ein Referendum sollte über Unabhängigkeit oder Verbleib bei Marokko entscheiden. Die Abstimmung fand nie statt.
Das Aussitzen des Konfliktes lohnt sich für das Königshaus in Rabat. Gegen Ende seiner ersten Amtszeit erkannte US-Präsident Donald Trump die Souveränität Marokkos über Westsahara an. Joe Biden machte dies nie offiziell rückgängig. Rabat nahm im Gegenzug – wie andere arabischen Länder zuvor – Beziehungen zu Israel auf. Abraham-Abkommen taufte die Trump-Administration diesen diplomatischen Vorstoß, der wie sich heute zeigt, den Mittleren Osten nicht beruhigt hat.
Und selbst Spanien, für die UNO noch immer die offizielle Verwaltungsmacht Westsaharas, geht auf Marokko zu. 2022 erklärte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez, dass eine Autonomie innerhalb Marokkos, die einzige mögliche Lösung des Konfliktes sei.
Phosphatplünderung. Für Sidi Omar, Vertreter der DARS bei der UNO in New York, erschwert diese Entwicklung die Bemühungen der UNO um eine friedliche und gerechte Lösung des Konflikts. Omar wurde 1970 in Smara im Norden Westsaharas geboren und floh mit seinen Eltern 1975 vor den marokkanischen Bombenangriffen nach Algerien, wo er in Flüchtlingscamps aufwuchs. Er besteht auf die Erfüllung der UN-Resolutionen, nach denen nur ein Referendum die Zukunft Westsaharas besiegeln kann, alles andere verstoße gegen das Völkerrecht.
Doch natürlich weiß auch Omar, dass die Zeit für Marokko arbeitet. Die Urlaubsflüge an der Küste Westsaharas seien nur ein Beispiel von vielen. Indes verkauft Marokko unter anderem Bodenschätze, allen voran Phosphatgestein aus Westsahara, das dem Maghreb-Staat seit Beginn der Besatzung enorme Einnahmen beschert hat. Jetzt wird gar Elon Musk sein Starlink Satelliteninternet für die besetzten Gebiete aktivieren. Unternehmen, die dort tätig sind, sowie den Urlauber:innen soll es an nichts fehlen, auch nicht an schnellem Internet.
Zumindest die EU-Fischereiflotten dürfen vor der Küste Westsaharas nicht mehr fangen. Die Fischvorkommen gehören Marokko nicht, so ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) von vergangenem Oktober. Der EuGH stufte das Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko erneut als rechtswidrig ein, weil es Westsahara miteinbezog, ohne dass das Volk der Sahrauis zugestimmt hatte.
Mauer der Schande. „Westsahara ist nichts, womit irgendwelche Dritte handeln können“, sagt Malainin Lakhal, der die DARS in der Afrikanischen Union vertritt, in der sie seit 1982 Vollmitglied ist. Er spricht über den Deal zwischen Trump und Rabat, der die Unterstützung Marokkos in Westsahara an Beziehungen mit Israel bindet. „Kurzfristige Interessen werden über Recht und Gerechtigkeit und auch über langfristige Stabilität gestellt“, beschwert sich der 53-jährige sahrauische Schriftsteller.
In den vergangenen fünf Jahren ist es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den marokkanischen Truppen und der Polisario gekommen, die von Algerien militärisch unterstützt wird. Entlang des 2.700 Kilometer langen Sandwalls, mit dem Marokko die Besatzung absichert und den die Sahrauis „Mauer der Schande“ nennen, kommt es vermehrt zu Kriegshandlungen.
So mancher hoffte, das würde die letzte ungelöste Entkolonialisierung Afrikas in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit rücken. Doch abgesehen von ein paar kleineren Zeitungsartikeln bleibt das Geschehen in der Wüste weitgehend unbemerkt.
Reiner Wandler lebt in Madrid und berichtet für verschiedene deutschsprachige Tageszeitungen über Spanien, Portugal und Nordafrika. Er schreibt über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und in den vergangenen Jahren immer mehr über erneuerbare Energien.