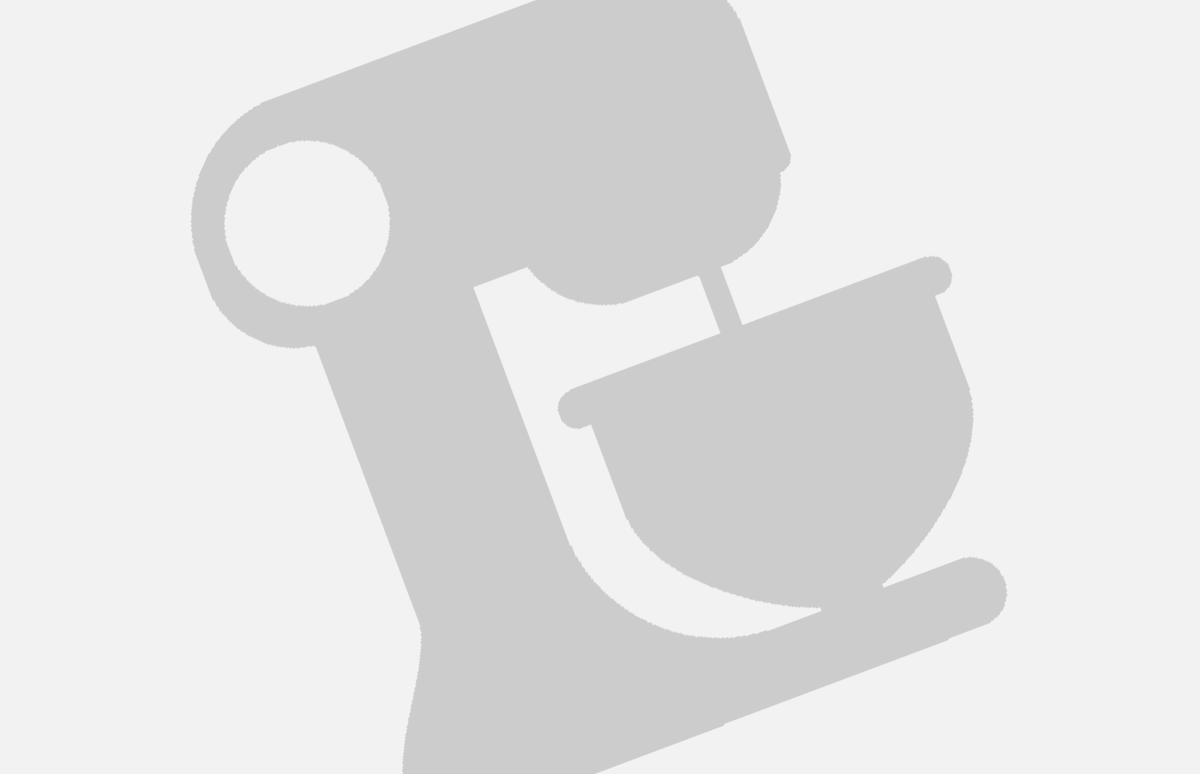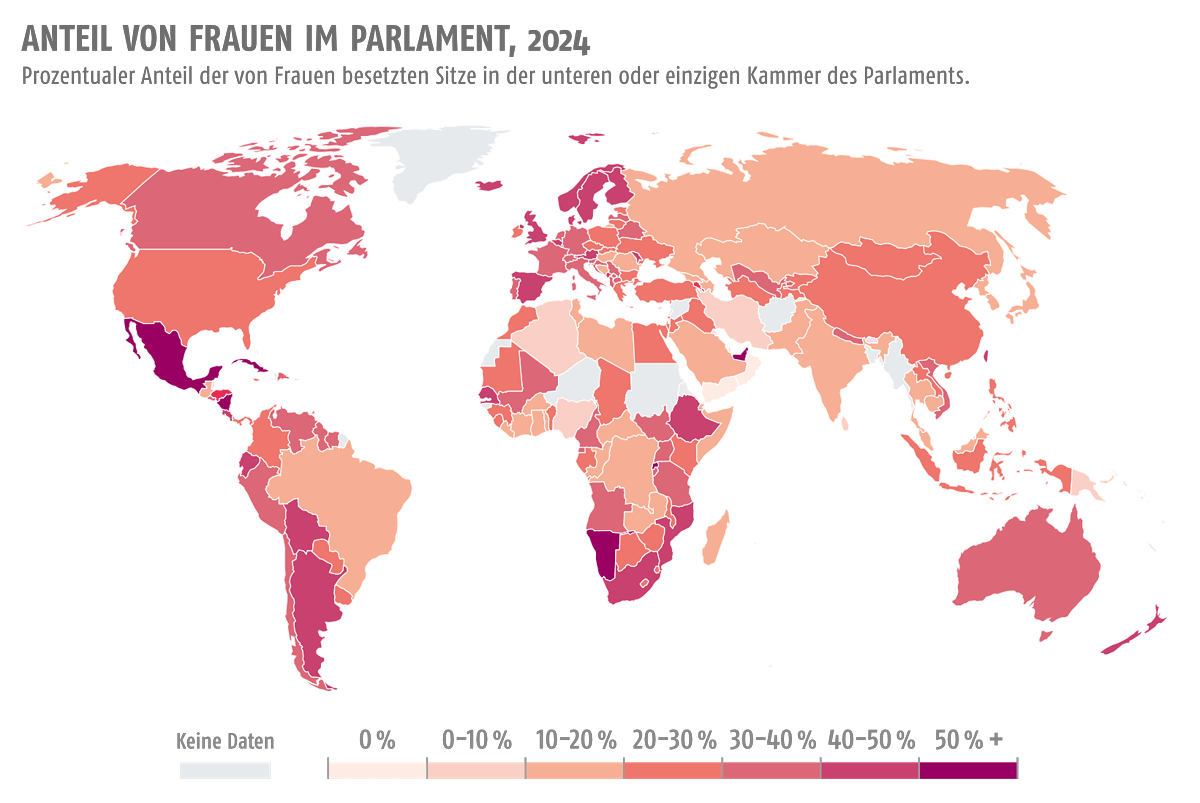
Der Krieg in Darfur im Westen Sudans ist eine Kombination aus uralter Konkurrenz um Landnutzung im Sahel und modernen Konflikten um die Macht in der Republik Sudan. Von Dominic Johnson
Der Krieg in Darfur ist ein besonders blutiger und besonders bösartig manipulierter Auswuchs des Konflikts um Landnutzung, der die gesamte Sahelzone Afrikas von Mauretanien bis nach Eritrea ständig latent heimsucht und immer wieder eskaliert. Die traditionelle Bewirtschaftung dieser Zone besteht in einem Nebeneinander aus sesshaften Bauernvölkern und saisonal umherziehenden Hirtenvölkern, die zu verschiedenen Jahreszeiten voneinander getrennt leben, zu anderen aber zusammenfinden müssen. Wenn die Trockenzeit die Wüste und angrenzende Regionen unbewohnbar macht, ziehen die Hirten nach Süden und finden dort Platz unter den Bauern, die dann gerade ihre Ernte eingeholt haben und das Land zu dieser Zeit nicht unbedingt alleine nutzen müssen. Dann wird auch Handel zwischen den beiden Gruppen getrieben, zum gegenseitigen Vorteil. Wenn der Regen kommt, ziehen die Hirten wieder nach Norden zurück und die Bauern können ihr Land bebauen. Das ist der alte Rhythmus, der das Leben im Sahel seit Menschengedenken bestimmt, und dessen saisonale Regelmäßigkeit bis heute die Wanderbewegungen zwischen Stadt und Land, das geschäftliche Leben und die Politik prägt. Die Trockenzeit ist die Zeit der Umtriebigkeit und Offenheit, die Regenzeit die der Einkehr. Revolutionen und Kriege werden vorzugsweise in der trockenen Jahreszeit vom Zaun gebrochen, und in der Zeit des Regens kann sich die Gesellschaft wieder beruhigen.
In Darfur funktioniert das schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr gut. Der Westen des Sudan ist ein Beispiel dafür, wie die zunehmende Beanspruchung von Ressourcen zu sozialen Krisen führen kann, die die Integrationsfähigkeit der Gesellschaften restlos überfordern. Sowohl bei Bauern als auch bei Hirten wächst die Bevölkerung, und mit ihr der Landbedarf. Die Bauernvölker dehnen sich nach Norden aus, die Hirtenvölker stellen im Süden immer größere Gebietsansprüche. In der ganzen Sahelzone bedeutete die große Dürre der 1970er Jahre einen Einschnitt, an dem diese Probleme offen zutage traten: Wenn die Zahl der Menschen und mit ihnen die Zahl der Rinder, Schafe und Ziegen wächst, während die Einkommensmöglichkeiten immer weiter schrumpfen, zerbricht irgendwann der Gemeinsinn. Der gegenwärtige Krieg der Janjaweed-Milizen in Darfur ist im Wesentlichen eine gewaltsame Landnahme durch die Hirtenvölker. Zu Hunderttausenden werden die Bauern der Fur, Massalit und Zaghawa aus ihren Dörfern und von ihren Feldern verjagt, das „freiwerdende“ Land füllt sich mit Vieh, während die Vertriebenen in Lagern an den Rändern der Städte im Elend leben und auf internationale Hilfe hoffen. Zum Teil machen die Janjaweed damit territoriale Verluste der vorangegangenen Jahrzehnte rückgängig, was aber nichts an der Brutalität ihrer Kriegführung relativieren sollte.
Dieser Konflikt wäre wohl nicht über das Niveau ähnlicher saisonaler Konflikte in Tschad oder Niger hinausgegangen, wenn es nicht im Sudan eine besondere, politische Komponente gäbe. Das Land befindet sich seit Jahrzehnten in einem Bürgerkrieg, der in die Zeit vor der Unabhängigkeit 1956 zurückreicht. Der schwarzafrikanische, nichtmuslimische Süden ist im permanenten Aufstand gegen die arabische, derzeit islamistisch geprägte Zentralregierung. Nach zwei Millionen Toten und fünf Millionen Vertriebenen einigten sich Sudans Regierung und Südsudans SPLA-Rebellen (Sudan People’s Liberation Army) im Juli 2002 auf einen Waffenstillstand und einen Friedensprozess, der zu einer Autonomie des Südens unter SPLA-Herrschaft führen soll. Die letzten Detailregelungen dafür unterschrieben die beiden Seiten im Mai 2004. Es war ein historischer Sieg für eine der ältesten Rebellionen der Welt und eine Ermutigung für alle Völker des Sudan, die sich von der Zentralregierung benachteiligt fühlen – eben auch in Darfur.
Die Darfur-Rebellenbewegungen SLA (Sudan Liberation Army) und JEM (Justice and Equality Movement) begannen ihren Krieg im März 2003 mit einem spektakulären Angriff auf Nord-Darfurs Hauptstadt El Fasher. Sie haben sich immer auf die SPLA als Vorbild bezogen und werden inoffiziell von dieser unterstützt. Hinzu kommt, dass die Zaghawa, aus denen sich vor allem die JEM rekrutieren, zumindest militärisch eine alte Vormachtstellung in der Region haben. Zaghawa-Krieger aus Darfur verhalfen 1990 dem heutigen Präsidenten des Tschad, Idriss Déby, zur militärischen Machtergreifung und bilden bis heute dessen treueste Truppen, was Débys heutige Position als Gastgeber von Zaghawa-Flüchtlingen aus Sudan politisch heikel macht.
Sudans Regierung wurde mit den Rebellen in Darfur relativ leicht fertig, ist doch Darfur traditionell das wichtigste Rekrutierungsgebiet für die sudanesische Armee. 80 Prozent der gegenwärtigen Regierungssoldaten sollen aus der Westregion stammen, eine der Folgen der ökologischen Krise der 1970er und 1980er Jahre, als immer mehr Angehörige der Nomadenvölker ihre Lebensgrundlage verloren. Die perspektivlosen Jugendlichen gingen zum Militär und lernten in Südsudan, wie man Aufständische bekämpft. Jetzt kehren sie als Milizionäre in die Heimat zurück und führen fort, was sie gelernt haben, ermutigt von den Behörden. Militärerfahrung haben allerdings auch die Kämpfer der Rebellenvölker, was dem Darfur-Krieg in seinen militärischen Konfrontationen eine für Sahelkriege unübliche Präzision verleiht, mit hohen Opferzahlen und Einsatz schweren Geräts bis hin zur Luftwaffe.
Die Rebellen sind heute nahezu besiegt, aber die Vertreibung der Bauern vor allem in Süd-Darfur an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik dauert an. Dass über eine Million Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben, nimmt Sudans Regierung hin. Es ist eigentlich auch nichts Neues in diesem kriegerischen Land, das schon viel schlimmere Hungersnöte erlebt hat als die, vor der Hilfswerke jetzt seit Monaten verzweifelt warnen. Die Hungerbilder aus Südsudan mit skelettierten nackten Kindern auf dem Wüstenboden gingen Ende der 1980er Jahre um die Welt und stehen bis heute als Mahnmal für den Horror afrikanischen Elends, aber aufrütteln ließ sich die Welt damals nicht. Es wurde einfach die „Operation Lifeline Sudan“ ins Leben gerufen, die von Kenia aus geleitete Luftabwürfe von Hilfsgütern für südsudanesische Kriegsgebiete organisierte und internationalen Hilfswerken Gelegenheit bot, sich zu profilieren. Warum sollte es heute in Darfur anders sein? Eine internationale „Operation Darfur“ für hungernde Kriegsvertriebene, vielleicht geleitet aus dem Tschad, wäre ein geringer Preis für die Regierung, die nicht gewillt ist, nach der Gewährung von Autonomie an den Süden weitere Autonomiebestrebungen zuzulassen.
Doch nicht einmal danach sieht es derzeit aus. Für die internationale Gemeinschaft steht Darfur zwar derzeit hoch auf der humanitären Prioritätenliste. Mit Forderungen nach einer internationalen Militärintervention und Schreckensszenarien einer massiven Hungersnot mit 350.000 bis eine Million Toten wird unterstrichen, dass Sudans Regierung nicht ungestraft massive Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begehen soll. Doch praktische Konsequenzen hat das eigentlich nicht. Ein Auseinanderbrechen des Sudan will niemand riskieren, und die Rebellen Darfurs, deren Verbindungen in Richtung der sudanesischen Islamisten im Dunkeln liegen, genießen international wenig Vertrauen. Da ist es sicherer, sich auf Hilfe für die Opfer zu beschränken und die politischen Ursachen des Konflikts den Sudanesen selbst zu überlassen, womit auch garantiert ist, dass der Konflikt immer weitere Opfer fordern wird. Eine durchdachte Politik für den Sahel gibt es im Sudan genausowenig wie sonstwo in Afrika.
Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur der Berliner Tageszeitung taz.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.