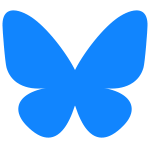Fast Fashion, fatale Folgen

Ausbeutung in der Bekleidungsindustrie: Wo sie anfängt, wohin sie führt und, wie sie gestoppt werden kann.
Weltweite Ausbeutung durchzieht die Modeindustrie. Bevor und nachdem Bekleidung getragen wird, verläuft sie wie ein roter Faden durch die Lieferkette jener Länder, in denen produziert wird zu jenen, in denen sie endet. In Asien und Afrika arbeiten Menschen unter unwürdigen, gesundheitsgefährdenden Bedingungen inklusive Hungerlöhnen. Sie leiden unter den tonnenweisen Altkleidern, die in Europa, USA und Asien weggeworfen werden, die sich zum Beispiel in Uganda auf den Mülldeponien zu Bergen türmen.
Wie ein Echo des Kolonialismus hallt hier wie dort schlecht bezahlte Arbeit nach: Etwa 90 Prozent der Jugendlichen und Frauen kommen mit ihren Löhnen kaum über die Runden. Einer der Gründe, warum sich das nicht ändert, ist, dass die wahren Kosten der Fast Fashion den Verbraucher:innen verborgen bleiben. Sie sehen weder den Überlebenskampf der Näher:innen, die ihre Kleidung hergestellt haben, noch denken sie daran, wo diese wahrscheinlich enden wird, nachdem sie aus der Mode gekommen oder aufgrund der schlechten Qualität zerfallen ist: Etwa in Uganda – einem von vielen afrikanischen Ländern, in denen die einst florierende lokale Bekleidungsindustrie mit vielen Beschäftigten auch wegen Strukturanpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfonds stark abgebaut wurde.
Kleiderspenden sind keine Wohltat
Tonnenweise wird Altkleidung von geringer Qualität in Europa und den USA an Wohltätigkeitsorganisationen oder Secondhand-Läden gespendet. Viel davon wird in Klassen kategorisiert und in Ballen in afrikanische Länder verschifft. Die meisten Händler:innen entscheiden sich für die erste Klasse, einstmals teurere und elegantere (Marken-)Kleidung. Die wird vor allem auf Secondhand-Kleidermärkten oder in lokalen Boutiquen im ganzen Land verkauft.
Eine der wichtigsten Einnahmequellen Ugandas ist Baumwolle. 95 Prozent der Produktion wird allerdings als Rohstoff in andere Länder exportiert, nur noch fünf Prozent werden von lokalen Textilbetrieben verarbeitet. Die Regierung versucht zwar mit der Initiative Buy Uganda Build Uganda, kurz BUBU, Investments anzulocken, aber den prekären Arbeitsbedingungen kommt sie nicht bei. Der informelle Sektor wächst, viele Menschen versuchen mit dem Sortieren von Altkleiderballen über die Runden zu kommen. Das ist eine gefährliche Arbeit, da sie die meisten – auch aus Mangel an Information – ohne Schutzkleidung verrichten und dabei viel Staub einatmen.
Lokale Produktion geht zurück
Die Baumwolle, die aus Uganda exportiert wird, kommt zu uns als Ausschussware zurück, nachdem sie in Europa, Asien oder den USA getragen wurde. 80 Prozent der in Uganda verkauften Kleidung stammen aus zweiter Hand.
Die lokale Produktion kann da nicht mithalten, obwohl die Kleidung, die aus dem Ausland kommt, Flecken hat, schmutzig oder zerrissen ist. Auf den örtlichen Märkten landen ungewaschene Unterwäsche, Babybekleidung und alle Arten von verschwitzter Sportswear, die irgendwo in irgendwelchen Läden gespendet wurde und dann an unsere örtlichen Märkte und Boutiquen zum Verkauf geschickt wurden. Vielen ist der Schaden, den ihre vermeintlichen Wohltaten verursachen, wahrscheinlich nicht bewusst. Die Menschen in Uganda wiederum glauben, dass die Bekleidung, die aus dem Ausland kommt von besserer Qualität und modischer ist, als jene, die noch im Land produziert wird.
Ausgelagerter Müll
Stinkende und gefährliche Mülldeponien sowie prekäre und unsichere Arbeitsverhältnisse sind die Folgen von Überproduktion und Überkonsum, auf denen die Modeindustrie basiert. Mit PR-Schlagwörtern wie „nachhaltig“, „ethisch“ und „bewusst“ gaukeln die Modeunternehmen den Verbraucher:innen vor, dass sie Teil der Lösung seien. Der derzeitige Produktions- und Konsumrhythmus der Fast Fashion kann jedoch per se nicht nachhaltig sein. 53 Millionen Tonnen Kleidung werden jährlich weggeworfen. Das heißt: Jede Sekunde wird mehr als ein Müllwagen voll Kleidung verbrannt oder auf einer Deponie entsorgt.
Einige afrikanische Länder, u.a. Ruanda, wehren sich mittlerweile gegen die wirtschaftliche Ausbeutung, indem sie die Einfuhr von Altkleidern verboten haben. Als Uganda diese Möglichkeit erwog, drohten jedoch die USA – auch, aber nicht nur deswegen – mit schweren Sanktionen, z.B. dem Ausschluss aus dem Handelsabkommen AGOA, das 40 Ländern in Subsahara-Afrika zollfreien Zugang zum US-Markt gewährt. Das zeigt, welch wichtige Rolle wir für die USA als Müllhalde spielen. Aber welchen Preis zahlen wir dafür jetzt und in Zukunft, wenn das alles so weitergeht?
Weniger wäre mehr
Eine wirklich nachhaltige Industrie kann erst entstehen, wenn die Arbeiter:innen in der Bekleidungsindustrie existenzsichernde Löhne bekommen, die es ihnen und ihren Familien ermöglichen, in Würde zu leben und sich Nahrung, Miete, Bildung und medizinische Versorgung leisten zu können. Das würde positive Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften haben und den seit der Kolonialzeit bestehenden Kreislauf der Armut durchbrechen.
Die Industrie muss weniger, aber qualitativ hochwertigere Kleidung produzieren, die für höhere Preise verkauft wird. Anstatt in einem Wettlauf nach unten über den Preis zu konkurrieren, müssen die Unternehmen die „wahren Kosten“ der von ihnen hergestellten Kleidung berechnen und diese in den Preis einbeziehen, den sie ihren Lieferant:innen zahlen. Das würde zu einer Verlagerung von Quantität zu Qualität führen. Verbraucher:innen würden weniger kaufen, ihre Kleidung mehr wertschätzen und weniger wegschmeißen. In der Folge käme auch weniger gebrauchte Kleidung nach Uganda und unsere lokale Bekleidungsindustrie würde wieder aufleben und mehr Arbeitsplätze vor Ort schaffen.
Gesetze gefragt
Es gibt jedoch mächtige Player, die daran interessiert sind, dass die Situation so bleibt, wie sie ist – weil sie davon profitieren. Von ihnen zu erwarten, dass sie das Richtige tun, ist keine Lösung. Wir brauchen dringend verbindliche Gesetze, um die Ausbeutung von Arbeitenden durch menschenwürdige Bedingungen und gerechte Bezahlung sowie die Zerstörung der Umwelt zu stoppen.
Ein gewerkschaftlich organisierter informeller Sektor, der die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen respektiert und fördert, kann bessere Arbeitsplätze, einvernehmliche Prozesse des sozialen Dialogs und eine transparente Zukunft für viele Ugander:innen in diesem Sektor schaffen. Genau hier setzt die „Europäische Bürgerinitiative“ für existenzsichernde Löhne für Textil- und Bekleidungsarbeiter:innen an. Sie fordert eine Gesetzgebung im gesamten Bekleidungs-, Textil- und Schuhsektor, durch die die Unternehmen dazu verpflichtet werden, eine Sorgfaltsprüfung für Einkommen, das Grundbedürfnisse deckt, in ihren Lieferketten durchzuführen und sie für Armutslöhne zur Verantwortung zu ziehen.
Irene Faith Lanyero arbeitet als stellvertretende nationale Schatzmeisterin und Organisatorin im Bereich Frauen und Jugend für die ugandische Gewerkschaft „Uganda Textiles & Allied Workers Union“. Als solche setzt sie sich vor allem durch Tarifverhandlungen, politische Maßnahmen und sozialen Dialog für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und junge Arbeitnehmende in der Textil-, Bekleidungs-, Leder- und Kunststoffindustrie Ugandas ein.
Der Beitrag erschien erstmals im Rahmen der Clean Clothes Campaign (CCC). Diese Version wurde übersetzt und gekürzt von Christina Schröder.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.