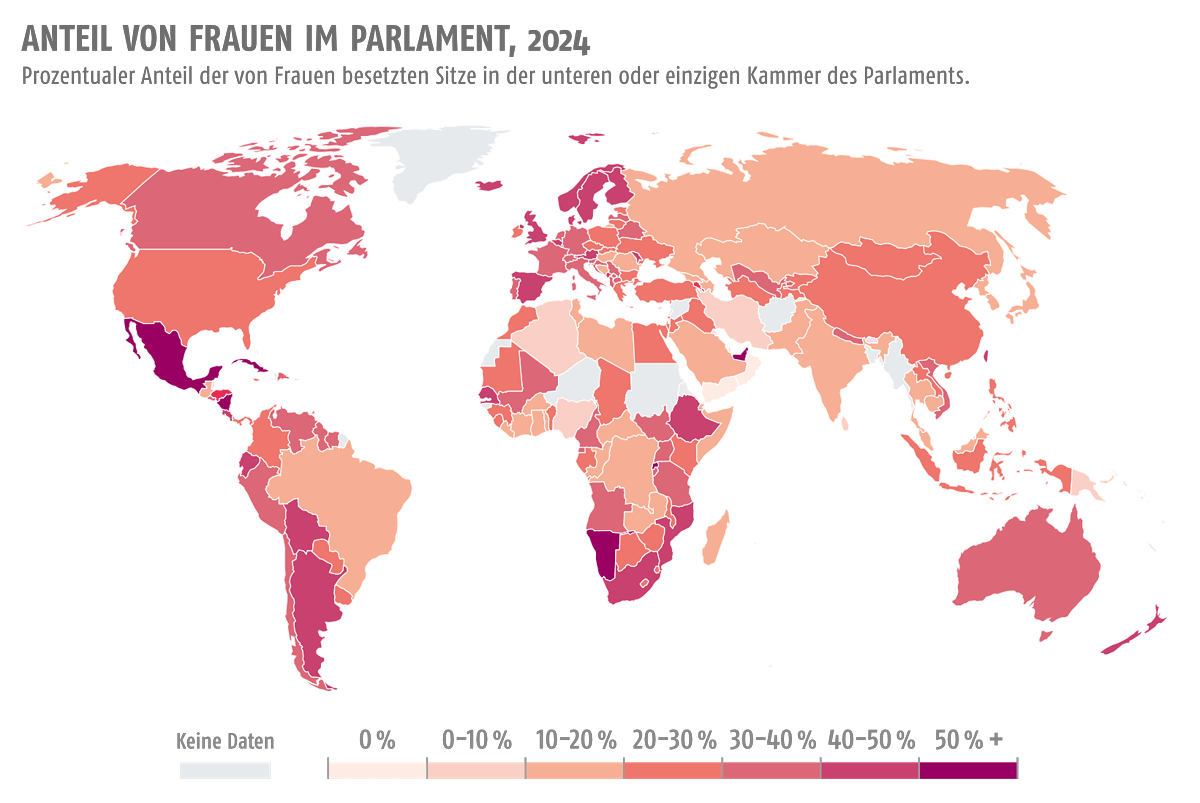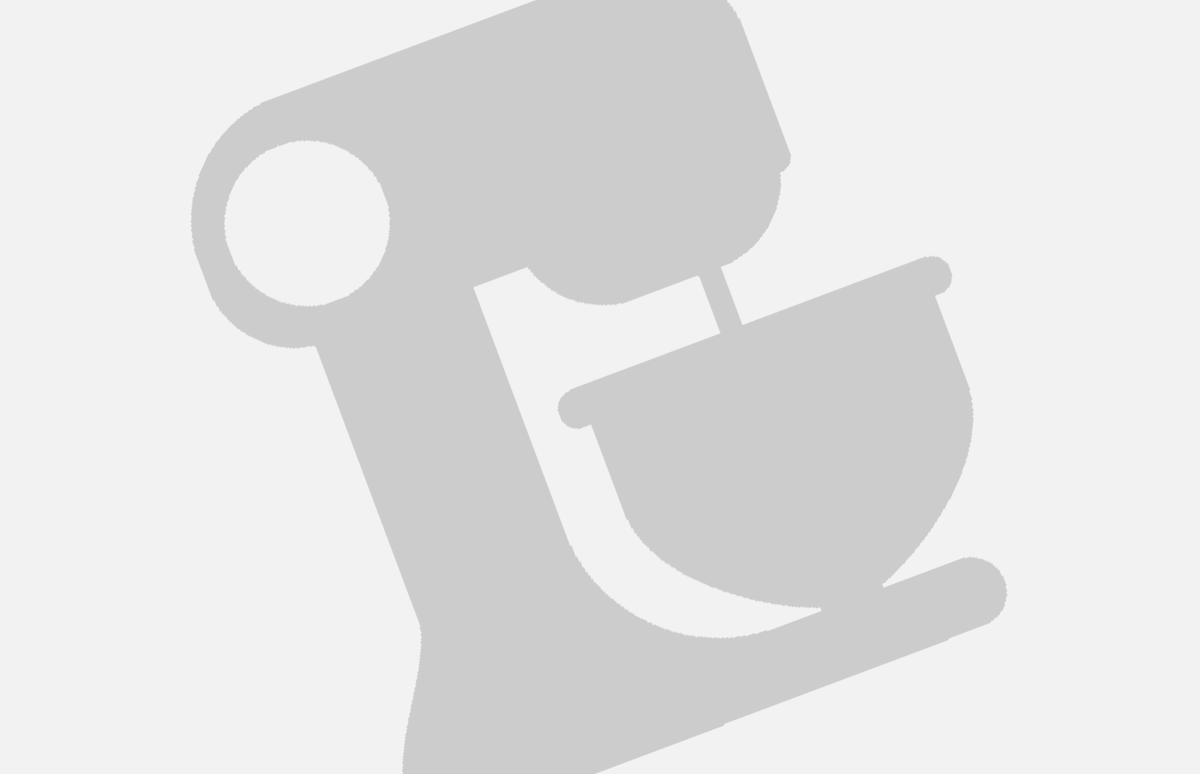
TabakpflanzerInnen in Kenia haben schon zu lange Verluste eingefahren, meint New Internationalist-Autor Joe Asila.
Enttäuschte BäuerInnen gibt es hier im Bezirk Kuria am Victoriasee, im Zentrum der wichtigsten Tabakanbauregion Kenias, mehr als genug. Chacha gehört zu einer wachsenden Gruppe von BäuerInnen, die begriffen haben, dass Tabak nichts einbringt. Sie werfen der Regierung nun vor, sie nicht vor den Risiken gewarnt zu haben. „Niemand hat uns gesagt, dass durch den Tabakanbau der Wald zugrunde geht, den wir für unser Feuerholz brauchen“, beschwert sich Peter Masaba, ein anderer Tabakpflanzer. Auf den Hügeln rund um sein Haus standen früher prächtige Bäume, die den Boden festigten und das Regenwasser zurückhielten. Heute ist von Bäumen nichts zu sehen. Sie wurden im Lauf der Jahre allesamt gefällt, weil das Holz gebraucht wurde, um die Tabakblätter zu trocknen.
Noch dazu hat die Arbeit in der Scheune, wo der Tabak getrocknet wird, die Gesundheit Masabas beeinträchtigt. Seine Augen tränen andauernd, eine Folge der ständigen Reizung durch den Rauch. Ersparnisse hat Masaba keine. Die Nutznießer, sagt er, sind vor allem die Tabakunternehmen, mit denen die BäuerInnen unter Vertrag stehen. Marktführer mit 55 Prozent Anteil ist die kenianische Tochter von British American Tobacco (BAT), gefolgt von StanCom Company (25 Prozent) und Mastermind Tobacco Kenya (20 Prozent). „Jedes Jahr geben die Unternehmen stolz bekannt, wie viel Steuern sie bezahlt haben, aber wer Tabak anbaut wie wir, der bleibt arm.“
Seit 1994 dürfen TabakpflanzerInnen nur für ein einziges Tabakunternehmen arbeiten und keinen Tabak „außerhalb der Saison“ anbauen. Wem das nützt, lässt ein Fax des Gebietsverantwortlichen von BAT Kenya vermuten: „Das Gesetz wurde eigentlich von uns entworfen, aber man muss der Regierung zu ihrer klugen Entscheidung gratulieren.“ Für die KleinbäuerInnen, die oft nur ein Viertel Hektar besitzen, sieht das etwas anders aus. 90 Prozent verstehen die Verträge nicht, die sie unterzeichnet haben. Festgelegt sind darin unter anderem der Ankaufspreis und die Ankaufsorte. Saatgut, Düngemittel und Pestizide werden den Bauern zur Verfügung gestellt; die entsprechenden Kosten, oft über den Marktpreisen, bringen die Unternehmen vom Ankaufspreis in Abzug. Sämtliche finanzielle Risiken tragen die BäuerInnen: Brennt eine Scheune nieder oder ruiniert Hagelschlag einen Teil der Ernte, ist das ihr Pech; müssen sie sich deshalb weiter verschulden, ebenso.
Tabakanbau heißt neun Monate Schwerarbeit. Landwirtschaftliche Geräte oder Traktoren gibt es kaum. Die ganze Familie arbeitet mit, die Kinder eingeschlossen: „Die Kinder werden von der Schule genommen, damit sie auf dem Tabakfeld mithelfen können. Einen gesunden Tabakbauern habe ich noch nie gesehen“, sagt die Beamtin Pauline Mwita. Auf andere negative Auswirkungen macht Helen Kibwabwa aufmerksam, eine Bezirkspolitikerin: „Männer heiraten viele Frauen, um mehr Arbeitskräfte für die Tabakfelder zu haben. Manche Frauen haben einen Arbeitsvertrag, aber wenn sie bezahlt werden sollen, holen sich ihre Männer das Geld, hauen es auf den Putz und überlassen die Frauen und Kinder ihrem Schicksal.“
Beim Tabakanbau müssen zahlreiche Chemikalien verwendet werden. BAT Kenya, so eine häufige Beschwerde, stelle nicht einmal grundlegendste Schutzvorrichtungen zur Verfügung. „Beim Tabakspritzen vergiftet man sich. Einige hier wurden ohnmächtig, als sie die Chemikalien einatmeten“, erzählt Samwel Moseti, ein Bauer in Kuria. Häufig sind etwa Kopfschmerzen, Übelkeit, Verstopfung, Haut- und Augenreizungen und Brustschmerzen. „Wenn gespritzt wird, kommen die Leute von den Tabakunternehmen niemals ungeschützt in die Tabakfarmen“, versichert Margaret Akinyi aus dem Nachbarbezirk Rangwe. „Aber wenn wir ohne Schutz arbeiten, ist ihnen das egal.“ Die Version von BAT Kenya klingt völlig anders. Gegenüber der britischen Hilfsorganisation Christian Aid etwa erklärte das Unternehmen: „Alle Bauern erhalten Schutzkleidung und werden in ihrem Gebrauch geschult. Die Letztverantwortung für das Tragen dieser Kleidung liegt bei den Bauern.“
Die Pestizide verschmutzen auch die Wasserläufe. „Wir brauchen den Fluss für alles Mögliche – zum Waschen, Trinken und Kochen“, erklärt der Arzt Japeth Opiya. „Alle diese Pestizide werden in den Fluss gewaschen; jeder ist davon betroffen, nicht nur die Bauern.“ Mit der Erntezeit stellt sich ein weiteres Problem, denn die Tabakpflanze ist selbst giftig. Pflückt man feuchte Blätter mit unbedeckten Armen und bloßen Händen, kann Nikotin durch die Haut in den Körper gelangen und Phänomene auslösen, die als „Green Tobacco Sickness“ bekannt sind: Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit, Bauchkrämpfe, Gelenksschmerzen und beschleunigter Puls.
Beim Verkauf schließlich, klagen BäuerInnen, würden die Leute von BAT die Qualität des Tabaks herabstufen, um den Preis zu drücken. Das ist durchaus wahrscheinlich. Es gibt keine unabhängigen Qualitätsprüfungen, und die Preise werden vom Unternehmen festgelegt. Die Erlöse der TabakpflanzerInnen fallen jedenfalls ziemlich dürftig aus. In der Bungoma-Region, fand Christian Aid heraus, zahlte BAT Kenya den BäuerInnen umgerechnet 7 US-Cent pro Kilo. Tatsächlich verdienten sie nicht einmal die Hälfte, wenn man die Kosten für die Chemikalien und andere Betriebsmittel berücksichtigt, die ihnen vom Unternehmen verkauft werden. Nach einer aktuellen Studie des Gesundheitsministeriums in Nairobi machen 80 Prozent der TabakpflanzerInnen Verluste. Sie schaffen es nicht, während der neunmonatigen Saison den Überblick über die Ausgaben zu behalten. Bei der Auszahlung sehen sie bloß das Bargeld, begreifen aber nicht, dass sie bei dem Geschäft schlecht ausgestiegen sind. Klar ist ihnen bloß, dass sie trotz Tabakanbau weiter von der Hand in den Mund leben.
Derartige geschäftliche Unfähigkeit ist BAT Kenya unbekannt. Kommt es hart auf hart, werden auch andere Seiten aufgezogen. 2001 etwa gab es in der Provinz Nyanza eine Rekordtabakernte, weit mehr als vom Unternehmen erwartet. Als BAT Kenya die geplante Einkaufsmenge überschritten hatte, wurden die Ankäufe einfach eingestellt – ein klarer Vertragsbruch. Vorbeugend drohte das Unternehmen den BäuerInnen damit, das Geschäft nach Uganda zu verlagern. Die Regierung sah dem Treiben tatenlos zu.
BAT hat bisher jede ernsthafte gewerkschaftliche Organisierung der TabakbäuerInnen bekämpft. Kürzlich trat eine neue Organisation namens NEWTFA (Nyanza, Eastern and Western Tobacco Farmers Association) auf. Die angebliche „Gewerkschaft“ wird jedoch tatsächlich von BAT Kenya unterstützt, um ein Gegengewicht zur Kenya Tobacco Growers Association zu schaffen. NEWFTA-Mitglieder dürfen Farmen nur in Begleitung von BAT-VertreterInnen besuchen.
Aber die NEWFTA hat schon ihre GegnerInnen – darunter die Kenya Anti-Tobacco Growing Association. „Die NEWFTA kann sich nicht für die Rechte der BäuerInnen einsetzen“, sagt ihr Generalsekretär George Kivandah. „Deshalb haben wir uns von einer Gewerkschaft in eine Organisation verwandelt, die gegen den Tabakanbau kämpft.“ Dem Parlament in Nairobi liegt gerade ein Gesetzesvorschlag des Gesundheitsministeriums vor, der weitreichende Reformen wie ein Verbot der Tabakwerbung und des Tabakverkaufs an Minderjährige vorsieht. Dasselbe Gesetz war bereits vor fünf Jahren eingebracht, doch auf Betreiben der Tabakunternehmen nicht beschlossen worden, wie es heißt. Einige lokale NGOs wollen durchsetzen, dass das Gesetz auch Schutzmaßnahmen für TabakpflanzerInnen vorsieht. Aber ihr eigentliches Ziel besteht darin, den Tabakanbau überhaupt einzustellen und durch den Anbau von Nahrungsmitteln und anderen Produkten zu ersetzen.
Copyright New Internationalist
Joe Asila hängte seinen Beruf als Finanzexperte an den Nagel, um Pastor einer Pfingstgemeinde zu werden. 1996 gründete er das SocialNEEDS Network, eine NGO in Kenia, die sich gegen das Rauchen, für Recyclingprojekte und sauberes Wasser einsetzt. (Kontakt: socialneeds@hotmail.com) Der Artikel berücksichtigt einige Ergebnisse des im Jänner 2004 erschienenen Christian-Aid-Berichts „Behind the Mask“.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.