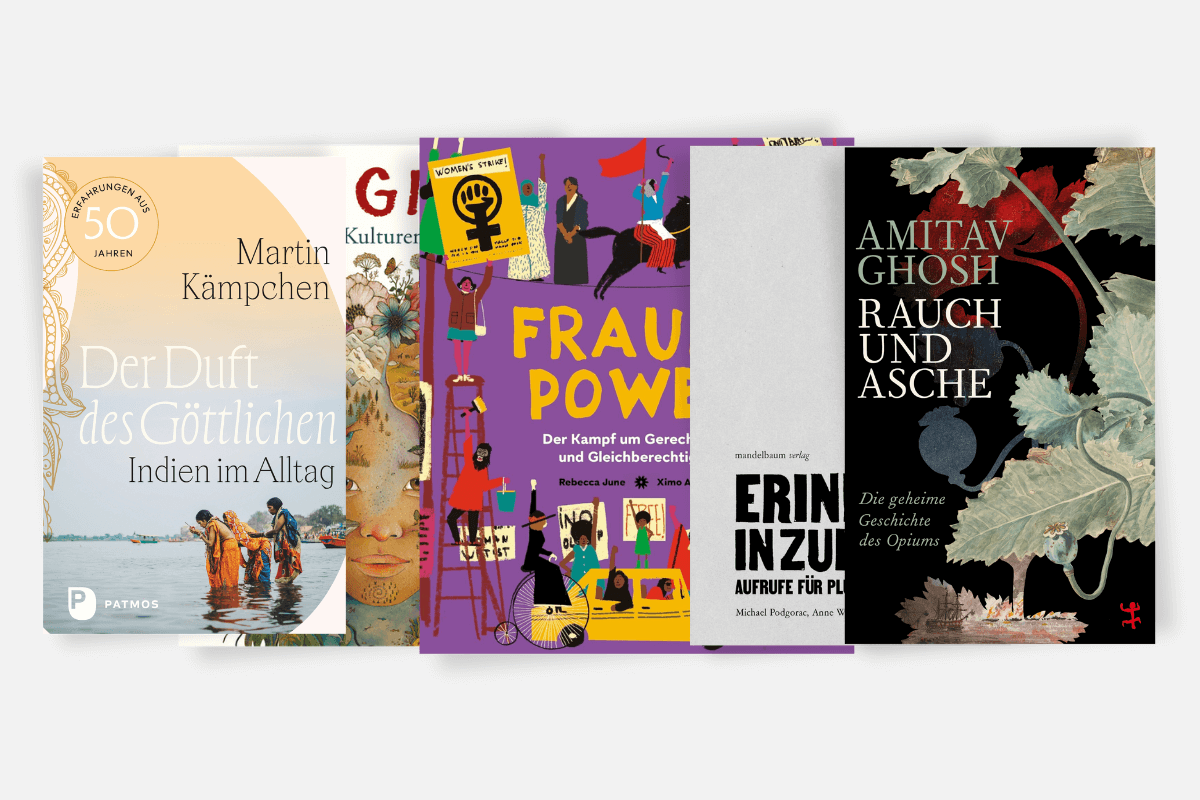
Das indische Kommerzkino, im allgemeinen als Bollywood bezeichnet, ist einer der wichtigsten Industriezweige des Subkontinents. Dabei besteht eine enge Beziehung zwischen Kino und Religion. Im Westen zieht das Exotische des Bollywood-Kinos die Menschen an.
Schon die Dimensionen sind gigantisch. Je nach Quelle werden hier mehr als 800 oder auch 900 Filme pro Jahr gedreht. Zwischen 1913, als Dhundhiraj Govind Phalke mit „Raja Harishchandra“ den ersten indischen Film produzierte, und 1981 wurden mehr als 15.000 Featurefilme in Indien gedreht; seit 1981 in etwa noch einmal so viele – wobei wiederum die Quellen widersprüchlich sind und es unklar ist, ob dies die Kommerzfilme aus anderen wichtigen Filmregionen wie den südlichen Bundesstaaten Andhra Pradesh („Tollywood“) und Tamil Nadu („Mollywood“) inkludiert oder nicht. Außer Zweifel aber steht: Die Filmindustrie zählt zu den zehn wichtigsten Industriezweigen des Subkontinents. Jeden Tag erwerben mehr als elf Millionen InderInnen eine Kinokarte. Da verwundert es nicht, dass FilmkritikerInnen immer wieder Kino und Religion assoziieren. Von den Kinos als den „Tempeln des modernen Indien“ spricht etwa Chidananda Das Gupta. Den segensreichen Blick auf den Gott im Hindu-Tempel (Darshan) überträgt Das Gupta aufs Kino, wohin die Gläubigen in großer Zahl pilgern, um sich in den Anblick ihrer neuen Götter, der Leinwandstars, zu versenken.
Europäischen Fans, die seit Ende der 1990er Jahre plötzlich die Möglichkeit hatten, eine ganze Reihe von Bollywood-Filmen in heimischen Kinos zu sehen, mögen vor allem die zahlreichen Gesangs- und Tanzsequenzen sowie die luxuriöse Ausstattung in Erinnerung bleiben. Das Exotische ziehe an, stellt eine der wenigen bislang gemachten Untersuchungen zur Attraktivität von Bollywood im Westen fest, und konstatiert doch zugleich auch eine gewisse Irritation über das Genre. Realitätsferne ist freilich kein Begriff, der nur in Europa fällt, wenn vom indischen Kommerzkino die Rede ist. Auch Regisseure des indischen „New Cinema“ oder „Parallel Cinema“ sowie diverse KritikerInnen haben sich immer wieder entsprechend negativ geäußert.
Die anhaltende Popularität eines Kinos, das die Menschen über alle regionalen, linguistischen, konfessionellen, klassen- und kastenbedingten Grenzen hinweg anzieht, erfordert indes eine genauere Analyse, wie die seit den 1980er Jahren wachsende Zahl seriöser akademischer Studien zum Bombay-Kino belegt. Krisen hat Bollywood immer wieder durchgemacht – infolge mangelnder Qualität der Produktionen, von denen ohnedies ein Gutteil stets nach wenigen Wochen für immer aus den Kinos verschwindet; infolge von Skandalen, denn auch der Einfluss der Unterwelt und die Nutzung als Geldwaschanlage gehört zu Bollywood; aber auch infolge der 1991 eingeleiteten Wirtschaftsliberalisierung. Damit kam das Satellitenfernsehen nach Indien. Nach mehreren Jahrzehnten bescheidener Kost in Doordarshan, wie sich das staatliche Fernsehen nennt, schien plötzlich eine Vielzahl von Fernsehkanälen mit Shows, Seifenopern und einem reichen Filmangebot das Bombay-Kino in ernste Nöte zu bringen.
Aber Bollywood lebt weiter – und strebt gar nicht nach Realitätsnähe, denn um die ging es ja nie. Der indische Kommerzfilm ist eine ganz eigene narrative Form, die häufig Anregungen aus Hollywood und gelegentlich auch aus anderen westlichen Genres aufgenommen hat. Seine wesentlichen stilistischen und narrativen Traditionen leiten sich vom indischen Volkstheater her, das sich zum Teil wiederum auf das klassische Sanskrit-Drama zurückführen lässt. Eine starke Ritualisierung, höchst theatralische Inszenierung und die kunstvoll-elaborierte Darstellung von Gefühlen prägen die überkommenen Theaterformen, in denen Musik und Gesang eine wichtige Rolle spielen.
Die beiden großen Epen, das Mahabharata und das Ramayana, wurden in Versen verfasst und über die Jahrhunderte durch Singen im Gedächtnis behalten und weiter gegeben. Auch zu vielen Schauspielen gehörten Gedichte, die gesungen oder melodisch vorgetragen wurden. Diese überkommenen ästhetischen Prinzipien wurden dann in das technisch neue Medium des Films übernommen, das selbstverständlich offen blieb für immer neue Einflüsse. Salman Rushdie hat in seiner Definition die Hybridität des Bombay-Kinos bestens zum Ausdruck gebracht. Nur ein häufig verwendeter Begriff fehlt darin – das Melodrama, als das das Bombay-Kino oft kurz bezeichnet wird. Masala (Gewürzmischungs)-Film ist eine andere beliebte Kurzformel.
Innerhalb dieses Kinos lassen sich – zumal in den ersten Jahrzehnten – diverse Genres unterscheiden wie der einst so populäre mythologische Film, der historische und der so genannte „soziale“, also mit eher zeitgenössischen Themen befasste Film. Doch die Tendenz zum Masala überwog zunehmend, und die Mischung wurde sukzessive angereichert mit neuen Gewürzen aus Kung Fu und Western, Spionage- und Katastrophenfilm, aber auch aus dem indischen „Parallel Cinema“. Musik und Tanz wurden durch viele neue Elemente aus regionalen Kulturen wie internationalen Moden beeinflusst. In einem aber blieb sich das Bombay-Kino stets treu: Seine Erzählform kommt ohne plausible, stringente Handlungsabläufe und psychologisch schlüssige Charaktere, ohne Beachtung von Raum-Zeit-Gesetzen, ohne durchgängige Kohärenz und gesamtfilmische Geschlossenheit aus. Dennoch ist dieses Kino weder völlig realitätsfern noch unpolitisch.
„Wenn dogmatische Realisten Hindi-Filme als unrealistisch abtun und beklagen, dass deren Handlungen und Charaktere die Grenzen der Glaubwürdigkeit überschreiten, dann beruht dieses herablassende Urteil zumeist auf einer eingeschränkten Sicht der Realität. Das Reale auf das zu beschränken und zu reduzieren, was als faktisch nachgewiesen werden kann, heißt, den Bereich des psychologisch Realen – dessen, was man als Innenleben empfindet – auszuschließen“, schrieb Indiens renommiertester Psychoanalytiker, der zuletzt auch als Romanautor bekannt gewordene Sudhir Kakar bereits in den 1980er Jahren. Und weiter: „Oder, um Bruno Bettelheims Beobachtungen zu Märchen zu adaptieren, Hindi-Filme mögen in rationaler Hinsicht unreal sein, aber sie sind sicher nicht unwahr. … Der Hindi-Film bezeugt ein sicheres Erfassen der Topografie der Sehnsüchte.“
Sudhir Kakar betrachtet das populäre indische Kino als „eine kollektive Fantasie, einen Gruppen-Tagtraum“. Unter Fantasie versteht er dabei eine Welt der Imagination, die von den Wünschen und Sehnsüchten der Menschen geschaffen wird. Über diese alternative Welt können die Menschen dann ihre Auseinandersetzung mit der Realität führen. Fantasie, verweist Kakar auf den Psychoanalytiker Robert Stoller, ist Trägerin der Hoffnung, sie heilt Traumata, schützt vor der Wirklichkeit, verdeckt die Wahrheit, festigt Identitäten, stellt Ruhe wieder her; sie ist die Feindin der Angst und der Trauer, die Reinigerin der Seele.
Männlich projiziertes Frauenbild: Diese Fantasien sind indes kaum feministisch angehaucht. Viele Hindi-Filme idealisieren das Bild der Mutter in ihrer mütterlichen Vollkommenheit und ihrem unentrinnbaren Leid. „Indem sie den vorwiegend orthodoxen Ansichten der überwiegenden Mehrheit ihres Publikums entsprechen, … bevorzugen Filmemacher im allgemeinen Frauenbilder, durch die die
männliche Vorherrschaft festgeschrieben wird“, betont die Kritikerin Aruna Vasudev. Angesichts des prägenden Einflusses, den die Epen und insbesondere das Ramayana mit der Gestalt der Sita, der vollkommenen Frau und Gattin, weiterhin auf weite Teile der Bevölkerung ausüben, ist nach Ansicht von Vasudev dieses Idealbild der Sita nicht so schnell zu überwinden – „zum Leidwesen der Frauen“. Das „Parallel Cinema“ weist demgegenüber eine wesentlich kritischere und differenziertere Auseinandersetzung mit der Frage der Geschlechterbeziehungen auf.
Ob man seine ideologische Ausrichtung begrüßt oder beklagt – das Bombay-Kino ist in jedem Fall eine wichtige Manifestation indischer Kultur. Als solche hat Sudhir Kakar, seit frühester Jugend ein eingeschworener Filmfan, es stets verstanden und als Theoretiker entsprechend ernst genommen. Der Hindi-Film, der „aus Bildern und Symbolen traditioneller regionaler Kulturen“ schöpft und „sie mit modernen westlichen Themen verbindet“, trägt nach Ansicht Sudhir Kakars ganz wesentlich zur Herausbildung einer „panindischen Populärkultur“ bei. Auch die Kritikerin Sumita Chakravarty hat in ihrem Werk über „National Identity in Indian Popular Cinema 1947-1987“ betont, dass bei allen Krisen und Problemen das kommerzielle Kino „das einzige Modell der nationalen Einheit“ bleibt, eine Aussage, auf die sich infolge ihrer bleibenden Relevanz auch im dritten Jahrtausend immer wieder FilmexpertInnen beziehen.
Kakar hat die Wechselwirkungen zwischen Volkskultur und Film mit großem Interesse verfolgt. So finden Volkstänze und säkulare oder religiöse Musikstile aus einer Region Eingang in einen Film, wo sie mit Musik- und Tanzelementen aus anderen Regionen und aus dem Westen vermischt werden. In dieser neuen Form kommen sie in Technicolor und Stereo über die Leinwand zu den BewohnerInnen der Herkunftsregionen zurück, die die neue Mischung dann in ihr traditionelles Theater, in ihre Lieder und Tänze aufnehmen.
Sogar die traditionelle Ikonografie von Statuen und Bildern für religiöse Andacht werde laut Sudhir Kakar von den filmischen Darstellungen von Göttern und Göttinnen beeinflusst.
Die genre-übergreifenden Einflüsse sind inzwischen noch vielfältigerer Natur. Mit der Liberalisierung ist auch MTV nach Indien gekommen. Auf dessen Charts machen einander Gesangs- und Tanzsequenzen aus verschiedenen Hindi-Filmen die Plätze streitig, was wiederum dazu geführt hat, dass bei der Produktion dieser Sequenzen für einen Film bereits auch auf deren gleichzeitige Verwertbarkeit als Videoclips geachtet wird. Diese Clips sind nur ein Teil einer gewaltigen Produktionsmaschinerie neben den eigentlichen Filmstudios. Der Kassetten- und CD-Markt lebt zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Hindi-Filmmusik. Ganz unabhängig vom Erfolg eines Films in den Kinos können einzelne Songs zu großen Hits in den Paraden werden. Unzählige Filmmagazine werden heute publiziert. Der Wunsch vieler Jugendlicher, zu Bollywood Zutritt zu bekommen, hat zahllose Tanzschulen entstehen lassen. Und auch die Schönheitsindustrie hat Aufschwung bekommen. Aussehen spielt eine größere Rolle als je zuvor, zumal nach dem Wechsel von Schönheitsköniginnen wie Ashwarya Rai nach Bollywood.
Die 1990er Jahre sind geprägt durch zwei Entwicklungen: den Aufschwung des politischen Hinduismus (Hindutva) sowie, in Zusammenhang mit der Liberalisierung, der neuen Rolle der indischen Diaspora, der, wie sie im Subkontinent genannt werden, NRIs (non-resident Indians, nicht in Indien lebende Inder). Beide Trends spiegeln sich in den Filmen wider. Daneben versuchen eine Reihe junger Regisseure, lebensnähere Filme mit realistischeren Dialogen zu machen, wie etwa Farhan Akthar in seinem „Dil Chalta Hai“.
„Patriotismus und ein ziemliches Maß an Chauvinismus schleichen sich in viele Filme ein“, betont die Kritikerin Madhu Jain. „Zugleich gibt es auch eine Bestätigung traditioneller und regressiver Werte.“ Das „desi dil“ (das einheimisch-indische Herz) wird zwar in eine moderne Technologie verpackt, aber es bleibt indisch und könnte gar nicht traditioneller sein. „Die Familie ist immer heilig, und das gleiche gilt für das Land und seine Traditionen.“ Da spielt es keine Rolle, ob die Stars für die Gesangs- und Tanzsequenzen in die Schweiz, nach Österreich oder nach Kanada jetten und sich pro Sequenz in zehn verschiedenen coolen Outfits zeigen.
Drei Regisseure sind führend in diesem Bollywood der 1990er Jahre: Sooraj Barjatya, Aditya Chopra und Karan Johar. Barjatyas Filme „Maine Pyar Kiya“, „Hum Aapke Hain Kaun“ und „Hum Sath Sath Hai“, Chopras „Dilwale Dulhan Le Jayenge“ und Johars „Kuch Kuch Hota Hai“ symbolisieren den neuen Trend. „Barjatyas Trilogie war nicht mehr und nichts weniger als eine Ode an die indische Großfamilie und den Status Quo. Er griff die Nostalgie nach einer hermetischeren, sichereren Welt auf, wo man den ganzen Tag gute Sachen essen, singen und Seiden-Saris tragen kann. Seine Formel, der andere später folgten, war einfach: Die Familie wurde eine Enklave, geschützt durch die hohen Tore ihrer weitläufigen Wohnsitze“, erklärt Madhu Jain. Die Außenwelt dringe kaum in solche Filme ein, Kriege, Armut, politische Konflikte blieben draußen. Nur der Clan existiere.
Die Soziologin Patricia Uberoi stößt in dieselbe Richtung und bestätigt die Thesen Sudhir Kakars , wenn sie „Hum Aapke Hain Kaun“ beschreibt als „die Geschichte der indischen Familie als eine Form von ‚imaginierter Gemeinschaft‘ … die Familie als eine Ikone der nationalen Gesellschaft. Das ist die Familie nicht wie sie ist, sondern wie sie sein sollte.“
Dass solche Filme großen Anklang finden, ist für den Regisseur Govind Nihalani selbstverständlich. Sie sind seiner Ansicht nach kennzeichnend für eine Gesellschaft im Umbruch. Das große Idol sei für viele der ökonomisch erfolgreiche NRI, der aber dennoch indischen Werten verbunden bleiben möchte. Laut Madhu Jain möchte der NRI – wie Inder im allgemeinen – „das Beste von beiden Welten. Sowohl Bhajans (devotionale religiöse Lieder) als auch Pop“.
Nach der Millenniumswende zeichnet sich auch in Bollywood wieder eine Wende ab, die das renommierte Magazin „India Today“ als eine Abkehr vom „Fahnen schwingenden, häufig xenophobischen Patriotismus“ interpretiert. Der Film „Veer und Zaara“, der in diesem Jahr auch in österreichischen Kinos zu sehen war, vertritt in seiner, die hochmilitarisierte indisch-pakistanische Grenze überschreitenden Liebesgeschichte ein neues Verhältnis zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten. In „Main Hoon Na“ ist der Bösewicht, der einen Gefangenenaustausch zwischen Indien und Pakistan gewaltsam verhindern will, ein fanatischer Hindu. In „Swadesh“ kehrt der Protagonist, ein bei der US-Weltraumbehörde Nasa erfolgreicher NRI, ins indische Dorf zurück, um dort Kastenbarrieren zu überbrücken, Unwissen zu bekämpfen und Energieprobleme lösen zu helfen.
Javed Akhtar, der angesehene Verfasser unzähliger Drehbücher, spricht von einem „intelligenteren Patriotismus für eine komplexere Ära: Der Feind ist Hunger, Krankheit und Not, nicht Pakistan“.
Brigitte Voykowitsch ist freie Journalistin mit dem Arbeitsschwerpunkt Süd- und Südostasien, von wo aus sie häufig für das Südwind-Magazin berichtet.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



