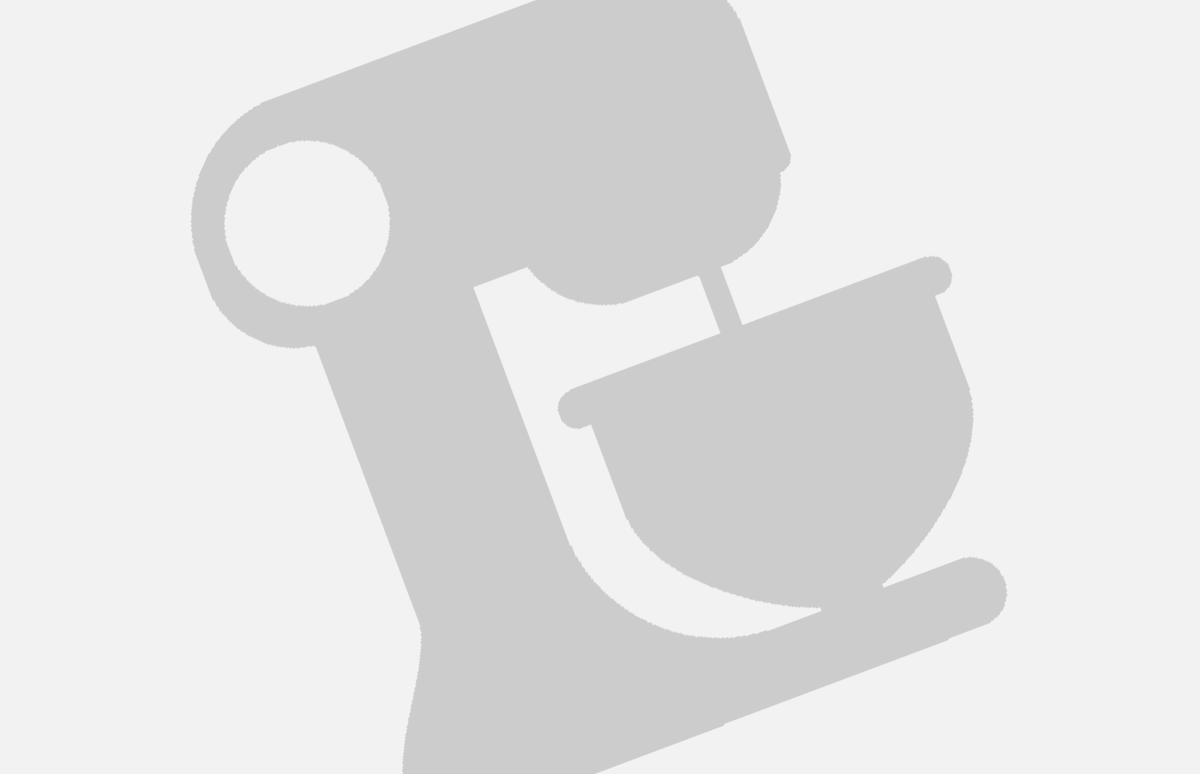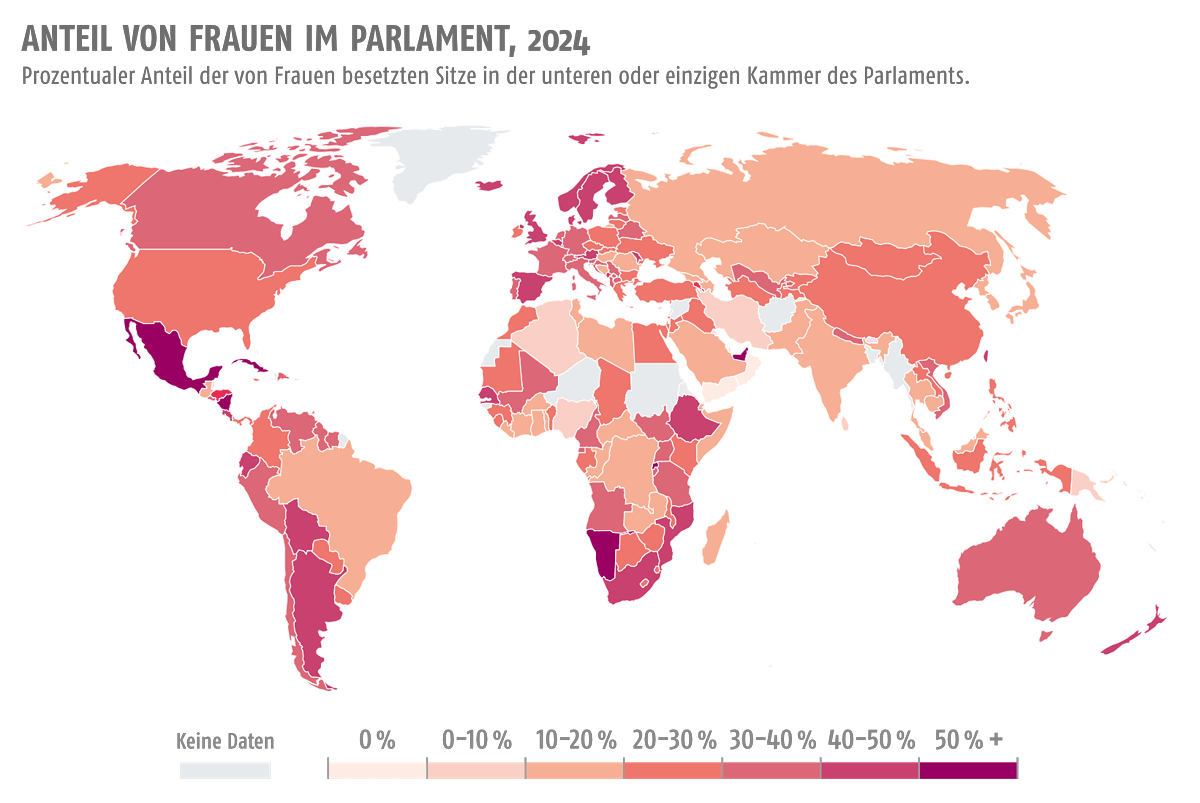
Ohne Demokratie gibt es keine Entwicklung für alle, heißt es. Und: In Afrika sei die Mitbestimmung der Bevölkerung besonders schwer zu verwirklichen. Enttäuschung mit der formalen Demokratie hat sich in vielen Ländern breit gemacht. Es wird nach Wegen gesucht, Entscheidungsmacht bei den betroffenen Menschen zu verankern.
Demokratie als System zur Regelung des Zusammenlebens von Mächtigen und Machtlosen kann nur von innen aus der Gesellschaft kommen. Es geht darum, dass die Mächtigen keine Allmacht haben und die Machtlosen ihre Rechte wahrnehmen können. In vielen afrikanischen Ländern jedoch wird Demokratie gleichgesetzt mit von außen eingebrachten Verfassungsmodellen. Diese bringen dann zwar Mehrparteiensysteme, Zweikammerparlamente, die Trennung von exekutiver und legislativer Gewalt und andere Errungenschaften der westlichen Welt – sie verhindern aber nicht, dass Träger eines staatlichen Amtes sich als über dem Gesetz stehend ansehen, Willkürherrschaft ausüben und ihre gewählte Amtszeit als Freibrief für Verbrechen während einer befristeten Zeit begreifen.
Keine zwei Jahrzehnte nach Beginn allgemeiner Revolten in zahlreichen afrikanischen Ländern gegen die Einparteienstaaten aus der Entkolonialisierung ist es paradox, dass neue Diktatoren auf der Suche nach Legitimität am liebsten Wahlen ansetzen. Faure Gnassingbé, Sohn des im Februar 2005 verstorbenen Langzeitdiktators von Togo, hatte es damit sehr eilig und ließ sich im April per Wahl im Amt bestätigen (siehe SWM 7-8/05) – in einem weithin kritisierten Wahlprozess, von Gewalt und Unregelmäßigkeiten begleitet, der massive Unruhen mit 800 Toten und über 30.000 Flüchtlingen zur Folge hatte.
Von Mauretanien bis Simbabwe sind Wahltermine Signale für angekündigte Zeiten der Instabilität, in denen der Staat und seine Gegner ihre Kräfte messen. Von Guinea bis Tschad gieren Autokraten danach, sich nach zwei gewählten Amtszeiten erneut zur Wahl stellen zu dürfen, und ändern dafür notfalls die Verfassung – so sicher sind sie sich, dass sie gar nicht verlieren können. Gegen diese Pervertierung der Demokratie greifen afrikanische Oppositionelle gemeinhin entweder zum bewaffneten oder unbewaffneten Widerstand – oder zum Rückzug aus dem Rahmen des anerkannten Zentralstaats in lokalere, informelle politische Zusammenhänge. Der erste Weg birgt das Risiko des Bürgerkrieges, der zweite das des Staatszerfalls.
Oft führt gerade das Bedürfnis nach Sicherheit in den Krieg: Weil die Menschen sich vor einem Willkürstaat schützen wollen, müssen sie ihre eigene bewaffnete Gegenmacht aufbauen – oder eine solche Gegenmacht wird von interessierten Einzelpersonen gegründet und dann der Bevölkerung als Lösung ihrer Probleme vorgegaukelt. Eine Antwort auf die Frage, wie man in Pro-Forma-Demokratien tatsächlich die andauernde Entrechtung der Menschen beenden kann, ohne gleich den Zusammenhalt des gesamten Staatswesens zu gefährden, ist schwer zu finden. Auch der vielgepriesene Rückgriff auf die „Zivilgesellschaft“ hilft da kaum weiter. Oftmals entziehen sich die Führer der „Zivilgesellschaft“ genauso der demokratischen Kontrolle wie die Führer des Staates; sie bauen kleine Privatreiche auf, komplett vom Ausland finanziert, und leisten sich einen permanenten Wettbewerb mit den staatlichen Institutionen darüber, wem von beiden mehr ausländische Entwicklungshilfe zusteht. Den Menschen hilft das wenig.
Nicht, dass es an Ideen mangeln würde. Im Jahre 2003 veröffentlichte das in Mali und Senegal gegründete Intellektuellennetzwerk „Dialogues sur la gouvernance en Afrique“ (Dialoge über Regierungsführung in Afrika) ein Thesenpapier „Changeons l’Afrique“ (Verändern wir Afrika) als „Projekt einer afrikanischen Charta für legitime Regierungsführung“. Darin wurden Grundwerte und Grundprinzipien festgelegt und ausgeführt: Gerechtigkeit als Grundlage des öffentlichen Handelns; Wahrnehmung der kulturellen und sozialen Realität afrikanischer Gesellschaften als Quelle jeder Legimität; Beteiligung aller an der öffentlichen Sache; Übernahme von Eigenverantwortung für Afrikas Entwicklung. Mit diesen und anderen Thesen, von Ousmane Sy aus Mali in die Öffentlichkeit getragen, begann eine Debatte über „gouvernance locale“, was auf Deutsch nur unzureichend mit „lokale Regierungsführung“ wiedergegeben wird: Es geht darum, die Entscheidungsmacht über politische und ökonomische Prozesse möglichst bei den jeweils Betroffenen zu verorten oder zumindest an einer Stelle, auf die die Betroffenen Einfluss nehmen können.
Das heißt zum Beispiel, dass die Zukunft der Ölförderung im Niger-Flussdelta von Nigeria von den Bevölkerungen der Region entschieden werden muss, nicht allein von den Ölkonzernen oder der nigerianischen Zentralregierung. In Nigeria wurde 1999 nach über 15 Jahren Militärdiktatur eine parlamentarische Mehrparteiendemokratie wiedereingeführt, aber der Ruf nach grundlegenden Verfassungsreformen ist danach nicht verstummt. „Ressourcenkontrolle“, also die Verfügung der lokalen Bevölkerung über die Verwendung der Einnahmen aus den jeweiligen Reichtümern, ist dabei das Schlüsselwort. Wie das ausgehen wird, bleibt offen. Präsident Olusegun Obasanjo berief dazu letztes Jahr eine „Nationale Politische Reformkonferenz“ ein, aber das Problem der Ressourcenkontrolle wurde in dem Juli 2005 vorgelegten Abschlussdokument ausgeklammert.
Ähnliche Diskussionen wie zu Nigerias Öl gibt es zum Bergbau im Kongo. Dort erfahren die Bevölkerungen der Bergbauregionen meist als Letzte und nur vom Hörensagen, welchem Investor die ferne Provinz- oder Zentralregierung oder einer ihrer Vertreter eine Mine oder ein Schürfgebiet zugesagt hat. Oft vergeben rivalisierende Politiker die gleichen Bergbaugebiete an rivalisierende Konzerne. Dann können sich lokale Milizen Krieg um die Bergwerke liefern – entweder im Sold dieser Rivalen oder mit dem Versprechen, im Falle eines Sieges den einen oder den anderen zu bevorzugen. Solche Prozesse liegen an der Wurzel vieler „kleinen Kriege“ zwischen Milizen in den Kivu-Provinzen Ostkongos oder im Distrikt Ituri an der Grenze zu Uganda.
Das Beispiel Kongo, wo während des Krieges das Land in mehrere Territorien von Warlords zerfallen war, zeigt, dass die Annäherung von Entscheidungsgewalt an die Menschen nicht allein durch Dezentralisierung oder Föderalisierung zu gewährleisten ist. Ein Warlord mag im gleichen Dorf leben wie ein Bauer – aber wenn der Warlord das Dorfland nachts per Mobiltelefongespräch einem mächtigen Gönner als Privateigentum zusichert, hat der Bauer genauso das Nachsehen wie wenn ihn das Parlament in der Hauptstadt per Gesetz enteignet.
Angesichts der für 2006 geplanten freien Wahlen im Kongo haben jetzt manche zivilgesellschaftlichen Gruppen Überlegungen angestellt, wie man den Wahlkampf auf den Kopf stellen könnte – beziehungsweise vom Kopf auf die Füße. Bisher läuft Wahlkampf in vielen armen Ländern so, dass die mächtigen PolitikerInnen bei ihren Wahlkampfreisen irreale Versprechen machen, aufgrund derer die begeisterte Bevölkerung sie wählt und dann hinterher bitter enttäuscht ist. Ein auf den Kopf gestellter Wahlkampf würde hingegen bedeuten, dass die Bevölkerung sich ihre Bedürfnisse selbst überlegt und daraus ein Wahlprogramm macht, das man den PolitikerInnen vorlegen kann. Wenn diese zusagen, es umzusetzen – was jeder tun wird – können die Menschen hinterher ihre gewählten FührerInnen an der Umsetzung der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse messen. Damit wird das politische System auch insgesamt repräsentativer für die gesellschaftliche Entwicklung.
Noch sind solche Überlegungen ganz am Anfang, aber sie zeigen, dass sich die Diskussion um die Zukunft der politischen Systeme weg von Formalien hin zur Realität bewegt. Denn bisher scheint Artikel 17 der Mandingo-Verfassung von 1236 der einzige zu sein, an den sich Afrikas postkoloniale Staaten erinnern.
Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur der Berliner Tageszeitung taz.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.