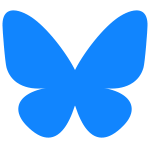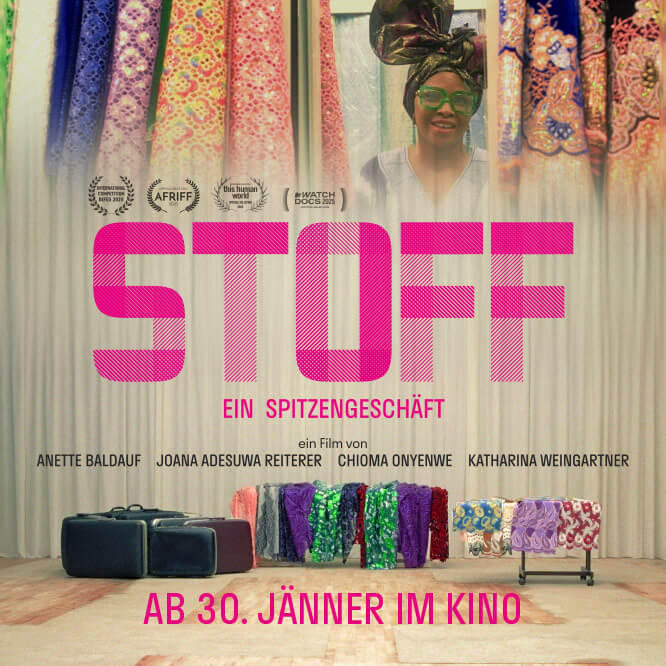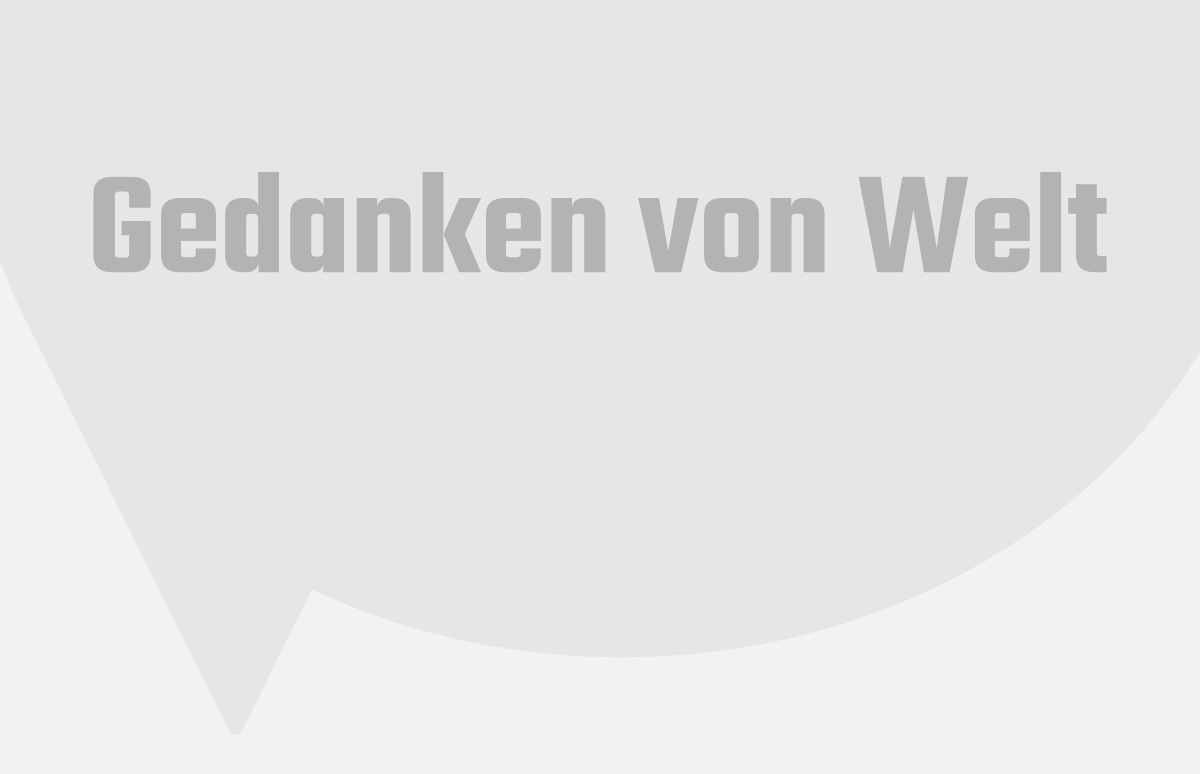
Vom italienischen Überfall auf Abessinien bis zu den Atombomben auf Hiroshima – der Zweite Weltkrieg war von Anfang bis Ende ein globaler Konflikt. Über die Rolle der Kolonialtruppen, Zwangsarbeit und darüber, wie nicht-europäische Erfahrungen – besonders in Österreich – bis heute ausgeblendet werden, spricht der Grazer Historiker Markus Wurzer.
Im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren kommt der Globale Süden selten vor.
Wenn in den Schulbüchern hierzulande steht, der Zweite Weltkrieg habe mit dem Überfall auf Polen im September 1939 begonnen und mit der Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 geendet, dann greift das zu kurz – es ist eine ausschließlich europäische Perspektive. Tatsächlich begann er bereits 1935 mit Italiens Angriff auf Abessinien in Ostafrika (auf dem Gebiet der heutigen Staaten Äthiopien und Eritrea, Anm. d. Red.) oder spätestens 1937 mit Japans Angriff auf China und endete erst im Herbst 1945 mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Schon daran sieht man: Der Zweite Weltkrieg war von seinem Anfang bis zu seinem Ende global.
Welche Rolle spielten die Kolonien europäischer Staaten im Krieg?
Erstens in der Bereitstellung von Soldaten: Frankreich und Großbritannien rekrutierten beispielsweise jeweils mindestens eine Million Soldaten in Afrika. Sie gingen nicht freiwillig, sondern wurden oft gezwungen. Ähnliche Zwangsrekrutierungen gab es in alliierten Kolonien in Südostasien genauso wie in den Kolonien der Achsenmächte, Italiens oder des Vichy-Regimes, in Nord- und Ostafrika. Soldaten aus dem Globalen Süden waren nicht nur in Europa, sondern auch in Teilen Afrikas, in Indien, Burma, Thailand oder Madagaskar im Einsatz.
Zweitens spielten die Kolonien eine zentrale Rolle bei der Zwangsarbeit. Sowohl die Achsenmächte, etwa in Nordafrika, als auch die Alliierten zogen Menschen im großen Stil zur Zwangsarbeit heran. Ein eindrückliches Beispiel: 1943 zwang Großbritannien rund 100.000 Männer in Nigeria, in Zinnminen zu arbeiten, um das für die Rüstungsproduktion notwendige Metall zu gewinnen. Etwa jeder Zehnte starb dort.
Drittens ging es um Rohstoffe, die Ausbeutung von Ressourcen – was freilich eng mit der Zwangsarbeit verbunden war. Die kriegsführenden Mächte pressten ihre Kolonien regelrecht aus: Lebensmittel, Textilien und andere kriegswichtige Ressourcen wurden entzogen, sodass den Menschen vor Ort kaum etwas zum Überleben blieb.
Gab es Unterschiede in der Behandlung kolonialer Soldaten zu weißen Truppen?
Pauschalaussagen sind schwierig, weil die verschiedenen kriegsführenden Mächte unterschiedlich mit den sogenannten Kolonialtruppen umgingen. Aber grundsätzlich wurden Soldaten aus dem Globalen Süden schlechter ausgerüstet, verpflegt und untergebracht. Sie wurden auch schlechter behandelt. Ihre Vorgesetzten waren weiße Offiziere, die von der behaupteten eigenen „rassischen“ Überlegenheit überzeugt waren und das ließen sie ihre Soldaten spüren. Koloniale Truppen setzte man zudem oft an besonders gefährlichen Frontabschnitten ein, wo hohe Verluste zu erwarten waren – gewissermaßen als Kanonenfutter. Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich auch in der Zeit nach dem Krieg: Während für europäische Veteranen Vereine und Verbände gegründet wurden, blieb den Soldaten aus den Kolonien jegliche Form von symbolischer oder finanzieller Anerkennung verwehrt.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen war auch im Zweiten Weltkrieg weit verbreitet. Warum wird das Thema im Kolonialkontext so selten behandelt?
Das Thema wird in der Geschichtsschreibung doppelt marginalisiert: Zum einen, weil der Zweite Weltkrieg im Globalen Süden insgesamt in Europa wenig Beachtung findet. Zum anderen, weil die Geschichte sexualisierter Gewalt im Krieg lange vernachlässigt wurde. Ein Grund da-für ist auch, dass geschlechtergeschichtliche Forschung nach wie vor zu wenig Förderung erhält. Entsprechend gibt es bis heute nur wenige Studien.
Antifaschistische Superheldinnen aus Südamerika
Kennen Sie Cora Ratto de Sadosky? Schon einmal von Fanny Edelman gehört? Beide waren zentrale Figuren im antifaschistischen Widerstand in Argentinien. Gemeinsam mit anderen Frauen gründeten sie 1941 die Junta de la Victoria, die internationale Hilfe für die Alliierten organisierte und sich gegen das autoritäre System in ihrem Land stellte. Die Gruppe wuchs auf 50.000 Mitglieder an und war laut Historikerin Sandra McGee Deutsch „die größte politische Frauenorganisation vor Perón“.
Cora Ratto de Sadosky war Mathematikerin und Menschenrechtsaktivistin. Als Professorin an der Universität von Buenos Aires prägte sie mehrere Generationen von Wissenschaftler:innen bis sie 1974 vor der rechtsextremistischen Miliz Triple A ins Exil flüchtete. Auch die Kommunistin Fanny Edelman machte sich ihr Leben lang gegen Unterdrückung und Faschismus stark. Sie kämpfte in Spanien gegen die Putschisten unter General Franco, führte die Unión de Mujeres de la Argentina und engagierte sich international in der Internationalen Demokratischen Frauenföderation (IDFF). Selbst mit 100 Jahren setzte sie sich noch für politische Gefangene, Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. Argentinien, das vor dem Krieg rund 45.000 jüdische Geflüchtete aus Europa aufnahm, war nach 1945 eines der begehrtesten Fluchtziele von Nazis.
Welche Auswirkungen hatte der Krieg auf die Zivilbevölkerung in den Ländern des Globalen Südens?
Die Auswirkungen waren gravierend. Die Bevölkerungen litten nicht nur unter Zwangsrekrutierungen und -arbeit. Auch ihre Lebensgrundlagen wurden durch den Krieg massiv in Mitleidenschaft gezogen. Lebensmittel wurden für militärische Zwecke beschlagnahmt und Anbauflächen zerstört. Die Achsenmächte beuteten beispielsweise Algerien dermaßen aus, dass die Bevölkerung an Hunger, Tuberkulose und Typhus litt. Ein anderes Beispiel ist China: 1938 entschied das Regime, den Gelben Fluss zu fluten, um den Vormarsch der Japaner aufzuhalten. Das hatte katastrophale Folgen für die Zivilbevölkerung: Etwa 900.000 Menschen starben, rund vier Millionen verloren ihr Hab und Gut, etwa 90 Millionen wurden zur Flucht gezwungen. Insgesamt kamen bis 1945 etwa 21 Millionen Menschen infolge der japanischen Aggression ums Leben. Der Krieg in Südostasien fand also keineswegs auf „leeren Inseln“ statt, wie es die Populärkultur manchmal suggeriert.
Sie haben u. a. zum sogenannten Afrikafeldzug geforscht, den Sie als rassistisch-antisemitischen Kolonialkrieg beschreiben. Inwiefern?
Italien beschloss erst im Herbst 1940, Ägypten – damals unter britischer Kontrolle – anzugreifen, um den Suezkanal, eine wichtige Seestraße, in seinen Besitz zu bekommen. Die Offensive scheiterte aber und Italien lief Gefahr seine Kolonien in Nordafrika zu verlieren. Deshalb griff NS-Deutschland ein, das eine südliche Front fürchtete, falls Nordafrika verloren ginge. Um das zu verhindern, entsandte es das sogenannte Afrikakorps nach Nordafrika. Für die NS-Propaganda war der Kriegsschauplatz besonders attraktiv, vor allem wegen der anfänglichen Erfolge des sogenannten Afrikakorps. Bis heute hält sich das Bild, die Panzerflotten des Feldmarschalls Erwin Rommel hätten sich ritterlich mit den britischen Truppen von Bernard Montgomery gemessen. Das hat wesentlich zum Mythos der „sauberen Wehrmacht“ beigetragen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass diese angeblich keine Kriegsverbrechen begangen habe. In Wirklichkeit war der Krieg in Nordafrika ein Kolonialkrieg, der die einheimische Bevölkerung unterdrückte. Rassistisch motivierte Gewalt richtete sich gegen Schwarze, aber auch gegen Juden und Jüdinnen. Sie wurden entrechtet, in Ghettos und Lager interniert, zur Zwangsarbeit gezwungen und ab 1942 teilweise in europäische Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.

Während in Europa 1945 das Kriegsende gefeiert wurde, begann im Globalen Süden vielerorts eine neue Phase der Gewalt. Wie hängt das zusammen?
Schon nach dem Ersten Weltkrieg – der ebenfalls ein globaler Krieg war – hofften die Kolonien für ihre Unterstützung auf Reformen und Anerkennung – doch sie wurden enttäuscht. Das stärkte antikoloniale Bewegungen und beflügelte die Kritik am Kolonialismus. Mit dem Zweiten Weltkrieg beschleunigten und verdichteten sich diese Prozesse.
Ein entscheidender Punkt war, dass koloniale Gesellschaften durch die Kriegserfahrungen sahen: Die sogenannten „Weißen“ sind nicht unverwundbar, sie bluten genauso wie wir. Besonders die Erfolge der Japaner gegen europäische Kolonialmächte in Südostasien erschütterten den Nimbus der Unbesiegbarkeit der Europäer:innen. Außerdem: Nach 1945 entstand eine neue Weltordnung mit den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Sie trugen ebenfalls dazu bei, den Einfluss der europäischen Kolonialreiche zurückzudrängen.
Inwiefern lassen sich diese Verflechtungen zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden im Kontext des Zweiten Weltkriegs auch an Österreich zeigen?
Zum einen trugen viele österreichische Soldaten den Krieg in die Welt. Etwa als Teil des sogenannten Afrikakorps, das Nordafrika ausbeutete und die Bevölkerung rassistisch unterdrückte, oder als Angehörige der Kriegsmarine, die nicht nur im Nordatlantik, sondern auch an den Küsten Zentral- und Südamerikas operierte.
Außerdem eröffnete das NS-Regime in Wien 1941 eine spezifisch auf den Kolonialdienst in Übersee ausgerichtete Polizeischule. Zahlreiche österreichische Beamte aus anderen Ressorts meldeten sich freiwillig zum bevorstehenden Kolonialdienst – zu einer Entsendung kam es ob des Kriegsverlaufs allerdings nicht. 1942 wurde die Schule schon wieder aufgelassen.
Und zum anderen wurden Menschen aus den Kolonien in Lagern in Österreich, etwa im KZ Mauthausen (siehe Seite 33, Anm. d. Red.) oder im Arbeitserziehungslager Reichenau in Tirol, interniert.
Und nach dem Krieg?
Als Österreich unter alliierter Verwaltung stand, waren auch afrikanische Soldaten in Österreich stationiert – in der britischen wie in der französischen Besatzungszone. Diese Präsenz hat Spuren hinterlassen: In Vorarlberg gibt es etwa die „Marokkanergasse“, die an dort stationierte Soldaten erinnert. Außerdem entstanden Kinder aus Beziehungen zwischen Schwarzen alliierten Soldaten und österreichischen Frauen. Viele dieser Kinder erlebten in ihrer Kindheit Diskriminierung und suchten ihr Leben lang nach den Identitäten ihrer Väter.
Eine Besonderheit ist, dass nach 1945 in Österreich – nicht nur an Stammtischen, sondern sogar im Nationalrat – die alliierte Verwaltung gelegentlich zur Kolonialherrschaft umgedeutet wurde. So meinte der Abgeordnete Ernst Koref (SPÖ) 1950, dass es Österreich in Bezug auf die eigenen Rechte kaum viel besser als einem „Kolonialvolk“ gehe. Diese Bezugnahme führte aber nicht zu Solidarität mit den Menschen im Globalen Süden. Sie diente allein dazu, die eigene Lage als besonders schlimm darzustellen. Natürlich war die Realität der Österreicher:innen nach 1945 nicht im Geringsten mit der Lebensrealität kolonialisierter Gesellschaften vergleichbar.
Wie hat sich Österreich nach 1945 außenpolitisch positioniert?
Das Land versuchte, sich vom NS-Regime zu distanzieren und als neutraler Staat neu zu erfinden. Besonders im „afrikanischen Jahr“ 1960, als viele neue Staaten im Globalen Süden entstanden, präsentierte man sich gerne als harmloser Partner fern jeder kolonialen Vergangenheit. Aber so einfach war es nicht: Österreichische Verflechtungen mit dem Kolonialismus reichen über den Nationalsozialismus und die Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur hinweg mindestens bis ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Habsburgermonarchie, zurück.
Interview: Christine Tragler

Markus Wurzer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz. 2023 erschien sein Buch „Der lange Atem kolonialer Bilder. Visuelle Praktiken von (Ex-)Soldaten und ihren Familien in Südtirol/Alto Adige 1935–2015“ im Wallstein Verlag.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.