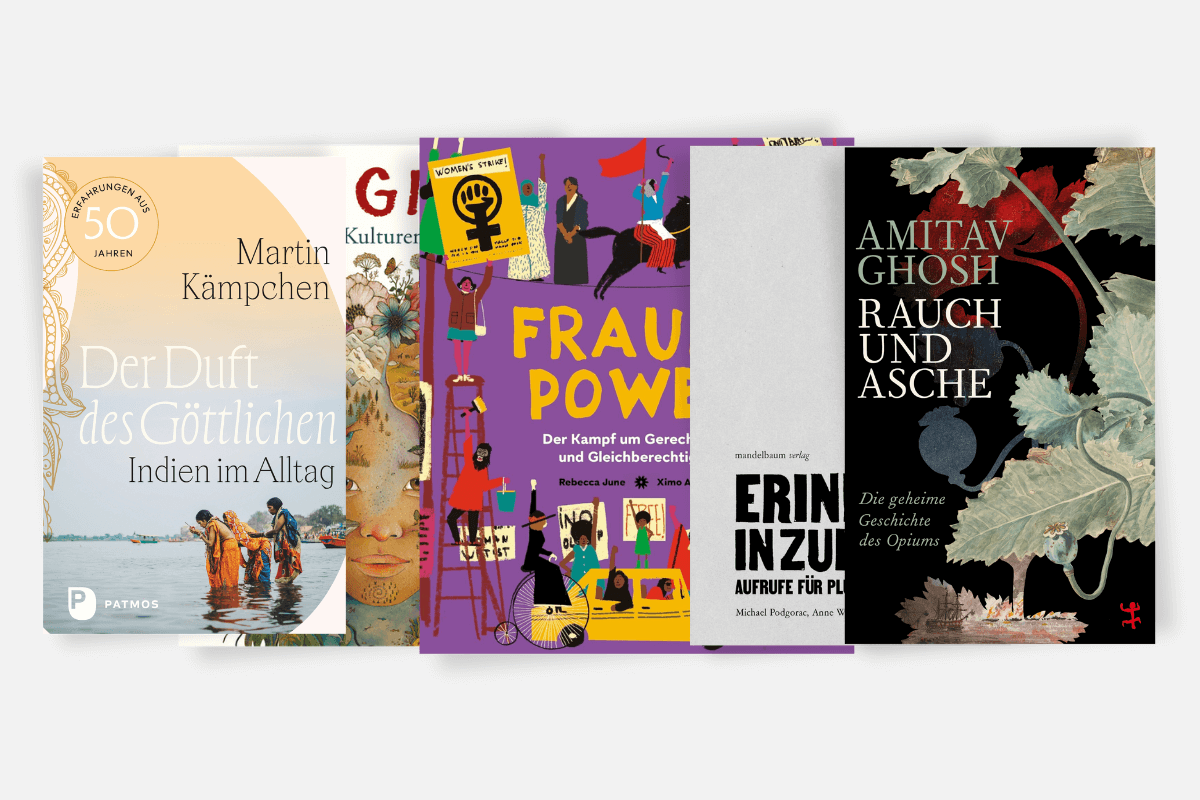
Südafrika hat zehn Jahre nach Ende der Apartheid nicht wirklich etwas zu feiern.
Die Dimensionen der über 80 Kilometer reichenden Johannesburger Stadtplanung aus der Apartheid-Zeit, mit ihrem nur scheinbar planlosen Nebeneinander aus Bergbauregionen, Stadtzentren, Wohnsiedlungen und Brachland und ihren zu Fuß unüberwindbaren Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsstätten, lassen schon am Tage das Individuum zur Ameise schrumpfen. Doch erst die Nacht fügt eine dritte, vollends unmenschliche Dimension hinzu: das Flutlicht aus hohen Masten, das anstelle einer individuellen Straßenbeleuchtung komplette Siedlungen einem gleichmäßigen Licht aus großer Höhe ausliefert. Es gibt keine Schatten, keine den Bedürfnissen des Einzelnen angepasste Beleuchtung. Dadurch gewinnt das Township aus der Ferne seinen ursprünglichen Charakter zurück: den eines Arbeitslagers, Orts der Überwachung und totalen Kontrolle. Die Erinnerung daran macht auch zehn Jahre nach Ende der Apartheid schlagartig wieder deutlich, wie weit Südafrika inzwischen auf dem Weg zu einer menschlicheren Gesellschaft vorangekommen ist – und wie präsent noch die totalitäre Unmenschlichkeit von damals.
Die Apartheid sprach dem schwarzen Bevölkerungsteil Südafrikas den Charakter des vollwertigen Menschen ab und reduzierte ihn auf eine volkswirtschaftliche Funktion. Diese Funktion, ungefähr die eines Arbeitstiers, wurde durch staatliche Planung geregelt; ansonsten waren die betroffenen Menschen in die Unsichtbarkeit verbannt. Südafrikas Schwarze wurden weniger als Bürger verwaltet und anerkannt denn als Werkzeuge missbraucht, gewartet und nach Abnutzung weggeschmissen. Die Townships und Homelands waren die Werkzeugkästen und Ersatzteillager, in denen der Meister eine Übersicht hält, aber wo menschliches Wohlergehen ein Fremdwort ist. Noch heute kann man aus dem ehemals weißen Johannesburg heraus die Schwesterstadt Soweto nicht sehen. Das „South Western Township“, Heimat für rund zwei Millionen Menschen, wird erst hinter Abraumhalden des Goldbergbaus sichtbar. Und umgekehrt wähnt man sich in Soweto wie in einer Metropole umgeben von Wüste. Erst wenn man das Township schon hinter sich gelassen hat, tauchen vorne die Hochhäuser des richtigen Johannesburg auf, wie eine Fata Morgana am Horizont.
Das heißt nicht, dass Soweto immer noch eine Ansammlung von Streichholzschachtelhäusern wäre wie vor Jahrzehnten. Aus dem Township ist eine Großstadt geworden, mit Einkaufszentren und feinen Restaurants, Villenvierteln und Slumsiedlungen wie überall in Afrika. Aber etwas fehlt: eine städtische Seele; das Gefühl, dies sei ein Lebensmittelpunkt. Das Township bleibt Vorstadt, so großstädtisch es auch sein mag.
Zehn Jahre nach Ende der Apartheid in Südafrika überschneiden sich die Lebenswelten von Schwarz und Weiß noch immer fast ausschließlich im öffentlichen Bereich, und auch da nur partiell. Der Durchschnittsweiße war nach wie vor noch nie in einem Township, und der Durchschnittsschwarze kennt die weißen Städte immer noch nur als Arbeitsräume. Der Durchschnittsweiße hält die ANC-Regierung für eine Verkörperung politischer Mittelmäßigkeit und nimmt dies als unvermeidbares Ergebnis der Machtübertragung an eine im Regieren unerfahrene Gruppe hin; der Durchschnittsschwarze sieht die Weißen noch immer als tendenziell überheblich und arrogant und erduldet ihre Existenz als unvermeidbare Verzerrung der eigenen Lebensperspektiven.
Zwei Welten, eine Nation – so kann man Südafrika heute beschreiben. Nun ist das Erreichen der einen Nation schon ein gigantischer Fortschritt. Damals, vor 1994, erschien ja tatsächlich wie ein Wunder, was heute so selbstverständlich erscheint: dass die jahrelangen Verhandlungen am Runden Tisch über eine demokratische Verfassung nicht an einem der vielen Stolpersteine zerbrachen; dass die immer blutigere Gewalt und die von Teilen des Sicherheitsapparates genährten Kriege zwischen Townshipmilizen nicht in einen regelrechten Bürgerkrieg mündeten; dass die hochgerüsteten Reservearmeen des Apartheid-Lagers, die jahrzehntelang Schwarze und Kommunisten bis aufs Messer bekämpft hatten, auf das mehrfach angedrohte reaktionäre Blutbad verzichteten; dass die explosive soziale Kluft zwischen entrechteter Mehrheit und einer wie Fettaugen auf einem Meer von Elend schwimmenden Minderheit nicht in den kompletten Zusammenbruch eines noch gar nicht geeinten Landes mündete.
Wenn schon das Nichteintreten einer Katastrophe eine riesige Errungenschaft darstellt, sind Utopien überflüssig. Sozialdemokratischer Reformismus in kleinen Schritten ist in Südafrika heute an der Tagesordnung, und die Regierung misst ihre Erfolge an der Zahl der Anschlüsse an die Wasserversorgung, an der Verbreitung der Bemessungsgrundlage für staatliche Beihilfen und an freiwilligen Quoten für Schwarze in der Wirtschaft. Penibel zählte Präsident Thabo Mbeki in seiner Zehnjahresbilanz vor dem Parlament Anfang Februar die Fortschritte auf: Nur noch fünf Millionen Menschen ohne Trinkwasser, gegenüber 16 Millionen 1994; nur noch 30 Prozent der Bevölkerung ohne Strom statt 60; 1,6 Millionen Wohnungen wurden gebaut und die Staatsschuld trotzdem von 64 auf unter 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückgefahren. Geradezu penetrant geht Südafrikas junge Demokratie Alltagsgeschäften nach, die eher des EU-Stabilitätspaktes würdig sind als der Herausforderung des radikalen Umbaus einer ganzen Gesellschaft, den zumindest 1994 die ANC-Wählerschaft für die kommende Aufgabe hielt.
Wie aus einer anderen Ära erscheint im Rückblick die von der ganzen Welt so begeistert gefeierte südafrikanische Euphorie nach dem langen Abschied vom abstrusen Albtraum namens Apartheid. Als im November 1993 bei den Verfassungsverhandlungen in Johannesburg nach Jahren des Zitterns endlich der Durchbruch kam, mischte sich der Jubel mit Ungläubigkeit, und in den Augen der Unterhändler blitzte hinter der festlichen Stimmung zuweilen Panik auf. Hatte man nicht vielleicht einfach ganz wesentliche Dinge vergessen, die das Land später ins Verderben reißen würden? War Südafrika damals nicht dabei, in einen Rausch zu verfallen, in dem man viel wunderbaren Blödsinn anstellt, aber aus dem man irgendwann mit einem grässlichen Kater aufwacht?
Es war ein entscheidendes Verdienst der Person Nelson Mandelas, als unerschütterlicher und allseits respektierter Optimist diese Restzweifel so beharrlich abzustumpfen, dass sie allmählich auf eine Restgröße ohne politisches Gewicht schrumpfen konnten. Mit einem Thabo Mbeki an der Spitze, der schon wieder in der verständlichen, doch verhängnisvollen Falle des postkolonialen Afrika gefangen scheint, sich immer gegen vermutete weiße Geringschätzung beweisen zu müssen, wäre die „eine Nation“ nicht so leicht entstanden. Doch heute wächst wieder die Zahl der Pessimisten in Südafrika, vor allem unter den Weißen, die den Teufel an die Wand malen und prophezeien, dass Südafrika irgendwann den katastrophalen Weg des benachbarten Simbabwe geht, wo die Regierung von Robert Mugabe konsequent den Rückwärtsgang vom Schwellenland ins Hungerland eingelegt hat.
Ein Grund für die Vorgänge in Simbabwe ist darin zu suchen, dass die Mugabe-Regierung nach harten Strukturanpassungsprogrammen die sozialen Erwartungen ihrer AnhängerInnen nicht mehr befriedigen konnte und stattdessen den populistischen Griff auf den Besitz der weißen Siedlerelite suchte. Dass auch für Südafrikas Zukunft die soziale Frage entscheidend ist, gilt als ausgemacht. Und die Zeichen stehen auf Sturm. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Die Weißen, so lautet das gängige Pauschalurteil, sind seit Ende der Apartheid reicher geworden, die Schwarzen ärmer. Jeder im Land weiß, dass das nicht so sein sollte. Die Reichen sind peinlich berührt, wenngleich sie Konsequenzen für das eigene Verhalten ablehnen; die Armen sind genervt, und manche träumen noch von alten Schlagworten wie Umverteilung des Landes und des Eigentums. Südafrika ist heute nicht in Feierstimmung.
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeichnen ein differenzierteres Bild, aber die Sache wird dadurch nicht besser. Das Durchschnittseinkommen des obersten Viertels des schwarzen Bevölkerungsteils ist seit 1994 um 30 Prozent gestiegen, das der unteren Hälfte ist um zehn Prozent gesunken. Die Dramatik dieser Entwicklung erschließt sich, wenn man sich erinnert, dass schon 1985, als die Armut geringer war als heute, vier Fünftel der schwarzen Bevölkerung sich auch nicht das einfachste Haus leisten konnten und zwei Drittel nicht einmal einen so genannten „serviced site“, also ein halbwegs erschlossenes Gelände zum Eigenbau einer Hütte aus Müll und Wellblech.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund 40 Prozent, und die formelle Wirtschaft wächst zu langsam, um daran etwas zu ändern. Massive Regierungsprogramme zum Wohnungsbau und zur Erschließung der Armensiedlungen mit Strom und Wasser mildern zwar die schwersten Begleitumstände der Armut, beheben diese aber nicht. Zehn Millionen Menschen, von rund 47 Millionen EinwohnerInnen, sind Untersuchungen zufolge heute ohne jede sichtbare und verlässliche Überlebensmöglichkeit.
„Zwei Ökonomien, ein Land“, diagnostizierte vor kurzem ein Rechercheteam im Auftrag der Präsidentschaft und verglich die zwei Ökonomien mit zwei Etagen eines Hauses, zwischen denen es keine Treppe gibt. Die obere Etage ist die der dynamischen formellen Wirtschaft, voller südafrikanischer Global Players, die sich anschicken, die Märkte und Rohstoffe ganz Afrikas zu erobern, und auch immer mehr schwarze Manager heranzüchten. Die untere ist die des unsteten Überlebens, der Landlosigkeit, Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit, die vergeblich auf die Brosamen vom Tisch der Volkswirtschaft wartet und immer verzweifelter wird.
Sozial gebeutelt sind die BewohnerInnen der unteren Etage auch durch die verheerenden Folgen der Ausbreitung von Aids, dessen Nichtzurkenntnisnahme wohl das größte Scheitern des neuen Südafrikas darstellt. Die Aidskranken und Infizierten sind die neuen Unsichtbaren des Landes. Zwar legte Südafrikas Regierung im November 2003 nach Jahren des Zauderns endlich einen Nationalen Aidsbekämpfungsplan vor, aber Präsident Mbeki sagte in seiner Regierungserklärung vom Februar 2004 nichts über dessen Umsetzung. Schon jetzt, wie die jährlichen Berichte des UN-Aidsprogramms UNAIDS darlegen, hat Südafrika mit über fünf Millionen Menschen die meisten „People Living With HIV/Aids“ der Welt. Im Jahre 2006, so schätzte vor drei Jahren Südafrikas Medizinischer Forschungsrat in einem Gutachten über die Sterbeentwicklung des Landes, dürfte die Zahl mit schätzungsweise 7,7 Millionen Menschen ihren Höhepunkt erreichen, bis danach die Sterberaten die Neuinfektionsraten überflügeln. Sollte die Sterberate jedoch nicht so hoch ausfallen wie damals erwartet, was neuere UN-Prognosen nahe legen, wird die Zahl der Infizierten noch höher steigen. Denn bei einer weiteren Ausbreitung der Pandemie sinkt die Zahl der „People Living With HIV/Aids“ erst dann, wenn mehr Menschen an Aids sterben als sich neu mit dem HI-Virus anstecken, und dann erledigt sich die Krise langsam auf biologischem Wege selbst – um den Preis von Millionen Menschenleben, die eventuell mit einer entschlosseneren Politik gerettet worden wären, und Millionen zerbrochener Familien, die ihren Kindern keine Zukunft zu bieten haben.
Die Aidswaisen und allein erziehenden Großmütter auf dem flachen Land gehören zu den Vergessenen des neuen Südafrika ebenso wie die Obdachlosen entlang der Abwässerkanäle der Townships und die ziellos streunenden Wanderarbeiter. Von schwarzen Angestellten in gepflegten Eigenheimen mit Vorgarten im gehobenen Teil Sowetos sind sie Welten entfernt und werden von diesen mit Herablassung behandelt.
Auch der ANC ist schließlich vor allem die Partei der schwarzen Gewinner, nicht die der Verlierer, die mangels Alternative die offizielle Politik längst abgeschrieben haben. Seine Basis ist vor allem die neue schwarze Mittelklasse, die durch positive Diskriminierung Schaltstellen in Politik und Wirtschaft erobert, und die durch die Gewerkschaften vertretene privilegierte Schicht von Menschen in einem formellen Arbeitsverhältnis.
Eine weitere Basis des ANC sind die etablierten traditionellen Strukturen in den ehemaligen Homelands, die gerade dieses Jahr durch ein neues Landgesetz massiv gestärkt werden – das einst rein staatseigene Land dort geht an von traditionellen Führern dominierte Räte, die dann über die Nutzungsrechte der Bevölkerung entscheiden können. Da außerhalb der einstigen Homelandgebiete der Großteil des landwirtschaftlich genutzten Landes immer noch im Besitz weißer Farmer ist, macht diese Neuregelung das Entstehen einer auf privatem Grundbesitz gegründeten bäuerlichen Mittelschicht so gut wie unmöglich, denn das Land bleibt im gemeinschaftlichen Besitz, und die Gemeinschaft kann Einzelnen nach Gutdünken das Recht auf Landnutzung erteilen oder verwehren. Das, so fürchten KritikerInnen des neuen Gesetzes, wird noch mehr Menschen an die Ränder der Städte treiben – vor allem Witwen und Waisen, deren Zahl aufgrund der Ausbreitung von Aids rasant wächst. Die Entwurzelung als Triebkraft der sozialen Entwicklung bleibt also bestehen und sorgt dafür, dass der südafrikanischen Gesellschaft der Charakter des Unsteten, des erzwungenen Provisoriums, erhalten bleibt.
Denn die städtische, formelle Wirtschaft arbeitet nach eigenen, ungeschriebenen Gesetzen. Die „richtigen“ Weißen, die sich mit Geld jene Privilegien bewahrt haben, die ihnen früher die Apartheidverfassung garantierte, ziehen sich ebenso zurück wie ihr Gegenpol ganz unten, aber in die umgekehrte Richtung. Sie werden nicht unsesshafter, sondern sie verbarrikadieren sich. Es vermehren sich die von privaten Sicherheitsdiensten abgesperrten Luxusenklaven in reichen Vierteln wie Sandton – Homelands für Reiche, vor allem Weiße, mit bewaffneten Grenzkontrollen und beschränkten Zugangsrechten für Auswärtige, vor allem Schwarze.
Nicht die Rasse, sondern die soziale Lage ist also das Trennende der geeinten Regenbogengesellschaft. Die früher herrschende Elite hat ihre elitäres Leben privatisiert. Die Macht im Staat musste sie aufgeben; die Macht in der Klassengesellschaft durfte sie behalten. Mit Verspätung merkt die Nation somit, worin der faule Kompromiss von 1993 tatsächlich bestand, dessen Leichtigkeit damals so verwunderte. So haftet dem ANC aus schwarzer Sicht der Makel der Janusköpfigkeit an. Weil er entgegen den jahrzehntelang gepredigten Grundsätzen die Weißen in Ruhe lassen musste, um diesen die Gewährung von Demokratie abzuringen, ist er die Partei des Verrats – und gleichzeitig gab es keinen anderen Weg.
Doch wenig ist, wie es scheint im neuen Südafrika. Aus den privilegierten Enklaven am oberen Ende der Gesellschaft fliehen die Menschen: zu Zehntausenden wandern qualifizierte Weiße und auch hoch qualifizierte Schwarze aus nach Australien, nach Großbritannien, irgendwohin in ein Land ohne Probleme. Ganz unten hingegen, wo das Überleben immer schwieriger wird, kommen immer mehr an – EmigrantInnen aus anderen Ländern Afrikas. Mehrere Millionen SimbabwerInnen allein zählt Südafrika heute, geflüchtet vor Mugabes Verelendungspolitik, aber auch Hunderttausende Menschen aus Kongo, Nigeria und Mosambik. Geblendet vom per südafrikanischem Satellitenfernsehen quer durch Afrika verbreiteten Schein der unbegrenzten Möglichkeiten Südafrikas, suchen die afrikanischen ImmigrantInnen ihren Platz an der Sonne und hängen jenem südafrikanischen Traum nach, aus dem die SüdafrikanerInnen selbst in ihrer Mehrzahl schon lange aufgewacht sind. Der Verdrängungswettbewerb wird härter.
Unvermeidlich ist damit wohl auch, dass eine gewisse Sehnsucht nach alten, überschaubaren Zeiten grassiert – jetzt, wo die große Zeit der Vergangenheitsbewältigung vorbei ist, wo die Wahrheitskommission ihre Arbeit abgeschlossen hat und die Geschichten von Opfern und Tätern der Apartheid nicht mehr interessieren. Zahlreiche soziologische Untersuchungen gerade in den Townships unterstreichen, wie sehr sich viele Menschen angesichts unberechenbarer Gewaltkriminalität nach früher sehnen, als die Polizei noch in ihrer Unmenschlichkeit berechenbar war statt korrupte Willkür auszuüben, und als aufgrund der strengen Passgesetze nur vertraute Gesichter in der Umgebung auftauchten. Und, vor allem: als Schwarze voreinander noch keine Angst zu haben brauchten.
Diese Zeiten hat es in Wirklichkeit nie gegeben, aber wer heute leidet, idealisiert gerne die Vergangenheit, vor allem wenn er danach gefragt wird. Die Flutlichtbatterien der Townships, die diese wie Gefangenenlager erscheinen lassen, sind heutzutage unter ihren BewohnerInnen hochbegehrt. Denn sie erschweren nächtliche Bandenkriminalität. Wo kein Schatten ist, kann sich auch niemand im Schatten verstecken. Vergangenes Jahr verkündete die metropolitane Verwaltung von Groß-Johannesburg einen umfassenden Plan, innerhalb von vier Jahren endlich flächendeckende öffentliche Beleuchtung zu installieren. Man wolle kein weißes Licht mehr, weil es Insekten anlockt, erklärte Projektleiter Brian Hlongwa und erkannte seine eigene Ironie dabei nicht. Bald leuchtet Johannesburg nachts einheitlich gelb. Dann ist auch optisch die Geschichte in die Unsichtbarkeit verbannt.
Der Autor ist Afrika-Redakteur der Berliner Tageszeitung taz.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



