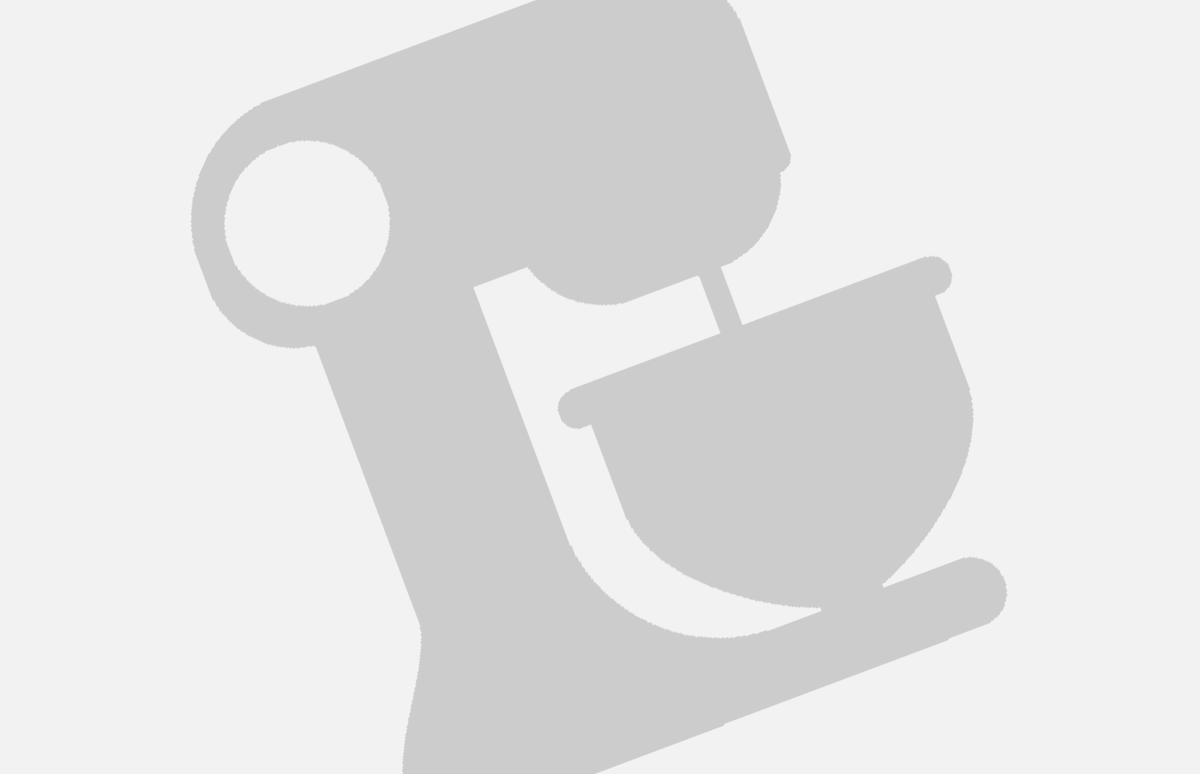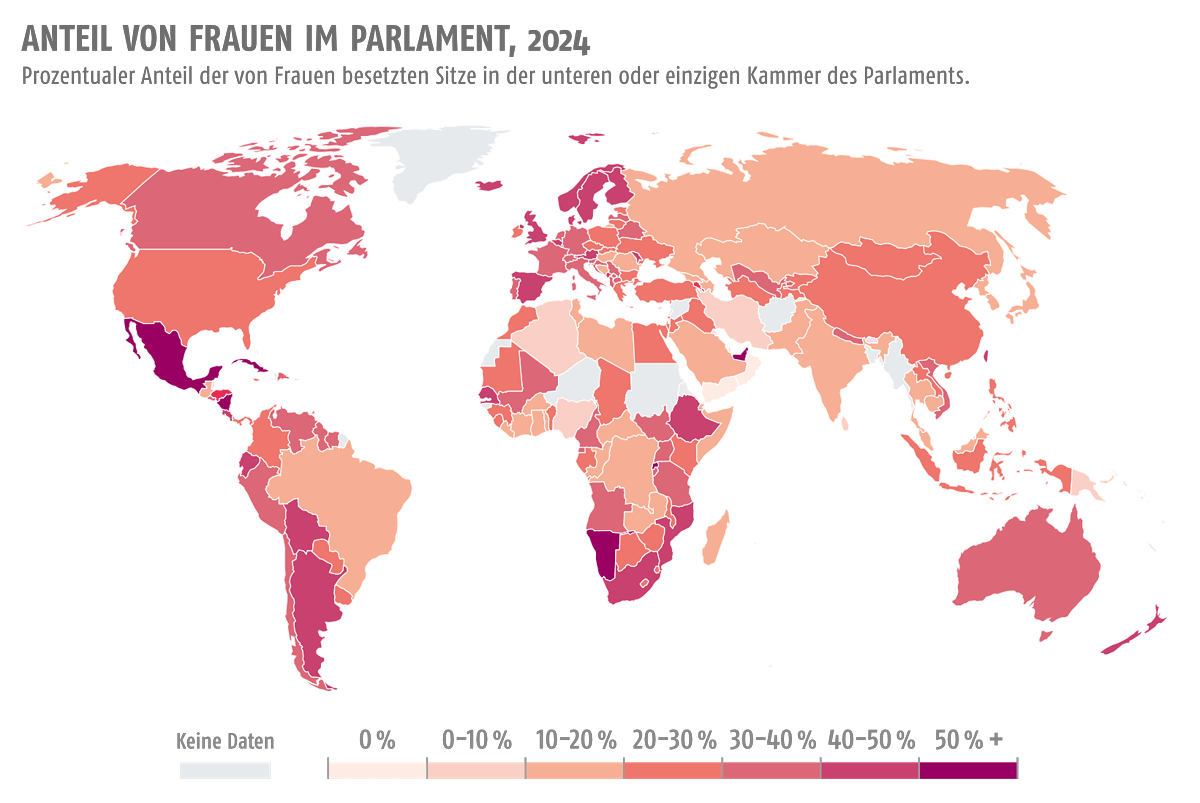
Einmal Grenze und zurück
Südafrika – Mosambik. Fast jeden Montag fährt ein Zug voll besetzt mit mosambikanischen MigrantInnen, die ohne Papiere in Südafrika festgenommen wurden, über die Grenze. Einige springen während der Fahrt ab, andere machen sich – kaum angekommen – auf den Weg zurück. Eine Reportage von Martina Schwikowski.
Flora Sibuyi, die im ersten Waggon mit 13 Frauen auf die Abfahrt wartet, ist eine von ihnen. Die 28-Jährige war vor wenigen Tagen morgens in ihrem einfachen Haus in Bekkersdal, anderthalb Autostunden von Johannesburg entfernt, aus dem Schlaf geholt worden – Polizisten hatten um fünf Uhr an die Tür gepocht. Floras Freund, ein mosambikanischer Minenarbeiter, war bereits zur Arbeit gegangen. Die junge Frau hat keinen Pass und war seit 1991 ohne Aufenthaltsbewilligung im Land. Bei der Polizeiaktion war sie gefasst und zum Flüchtlingslager Lindela, dem einzigen Sammelpunkt im Land, gebracht worden.
Heute mittag wurden die Frauen aus dem Lager in einem Polizei-Lastwagen die sieben Kilometer zum Bahnhof Robinson gefahren. Jetzt werden die Männer nach und nach aus dem „Repatriation Tunnel“ geholt, der sich unter freiem Himmel an das Lager anschließt. Es dauert Stunden, bis alle im Zug untergebracht sind.
Der Junge, der mit rot-fiebrigen Augen zitternd am Bahnsteig steht, wird wieder ins Lager zurückgebracht. Er ist zu krank, um die 15-stündige Zugfahrt mitzumachen. Die Polizisten, zwei vorne und zwei hinten in jedem Abteil, bewachen jede Geste. „Ich wette, schon bei der zweiten Zählung, etwa zwei Stunden nach der Abfahrt, werden einige fehlen“, prophezeit Ronny Marole, Leiter der Einwanderungsbehörde in weißem Hemd und schwarzer Hose, und grinst zum Abschied auf dem Bahnsteig. Dann knallen die Türen und der Zug rollt in den lauen Abend hinein.
Das südafrikanische Innenministerium lässt fast jeden Montag illegale EinwandererInnen aus Mosambik zurückschaffen. Am Mittwoch nimmt der Zug eine andere Richtung, dann geht es über die Grenze ins benachbarte Simbabwe. Neben Mosambik und Simbabwe stammen die meisten der illegalen GrenzüberquererInnen aus den Nachbarstaaten Lesotho, Swaziland und Botswana. Doch die MosambikanerInnen sind die größte Gruppe, die ohne Papiere ins Land kommt. Etwa 3.000 werden pro Monat abgeschoben. Die Behörden geben an, insgesamt jährlich 72.000 Menschen aus Südafrika in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Das kostet die Regierung rund 40 Millionen Rand (ca. fünf Mio. Euro) im Jahr. Und die Menschen geben ihren Traum von einer besseren Welt in Südafrika nicht auf. Das Land ist der wirtschaftliche Motor im südlichen Afrika, obwohl auch dort 40 Prozent arbeitslos sind.
„Zuhause kann ich nichts machen“, sagt Flora Sibuyi. „Ich dachte an ein schöneres Leben auf der anderen Seite.“ Ihre zehnjährige Tochter Kenzani und ihr siebenjähriger Sohn Menito leben bei der Mutter in Megudu, einem Dorf drei Stunden von Mosambiks Hauptstadt Maputo entfernt. Der Zug rattert über die Schienen. Zwei junge Beamtinnen der Einwanderungsbehörde haben gerade jede Person gezählt. Es ist kurz vor Mitternacht, und in Floras Abteil machen es sich die Frauen bequem. Die Stimmung ist aufgekratzt. Flora taut auf und überschlägt sich fast in Shangaan, ihrer Muttersprache: „Ich bin unter dem Zaun durchgerobbt“, erzählt sie und fällt in das Gelächter der anderen ein. Viele der Männer sind auf diese Weise ins benachbarte Südafrika gekommen. Aber auch Frauen versuchen, den elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun, der die kilometerlange Grenze in den Lebombo-Bergen zu Mosambik bildet, hinter sich zu lassen. Flora – damals 14 Jahre alt – war von Helfern an eine geeignete Stelle gebracht worden, hatte den Zaun mit einem Stock hochgesteckt und war schnell unten durch geschlüpft.
Entweder sind die Wachen gerade nicht in der Nähe oder werden geschmiert. Das gleiche passiert täglich an den Grenzposten mit falschen Papieren, gar keinen Papieren und Geld, das in entsprechende Taschen wandert. Damals, unter der Apartheidregierung, stand der Zaun allerdings noch unter Hochspannung.
Der Weg durch die Waggons ist mühsam, die Hände suchen Halt an den Gepäcknetzen, auf denen vereinzelt Männer gekrümmt schlafen. Zum Zählen müssen sie runter. Andere lehnen aneinander, mit nackten Oberkörpern oder in zerrissenen Kleidern, manche barfuß. Links und rechts sitzen sie jeweils zu dritt und starren vor sich hin. Keiner spricht. Viele husten und keuchen. Einige wurden direkt von der Arbeit in der Montur abtransportiert. Ein übler Geruch von Schweiß und Dreck durchzieht die Waggons, einige Polizisten tragen Mundschutz. Plötzlich schlingert der Zug heftig in einer Kurve, und im Chaos setzt ein Mosambikaner in der Mitte des Wagens zum Hechtsprung zum leicht geöffneten Fenster an. „He, was willst du da“, ruft die junge Beamtin, die ihn gerade abgezählt und sein Vorhaben aus den Augenwinkeln beobachtet hat. Er grinst verlegen und setzt sich wieder hin.
In den frühen Morgenstunden wird wieder gezählt. Müde Augen blicken leer, einige Polizisten schnarchen. „Das ist der Moment, wo normalerweise die Gefahr groß ist, dass sie abspringen”, sagt Polizeihauptmann Frank Hutchons bei seiner Inspektion kurz vor der Grenze. Der Zug quietscht auf den Gleisen und wird langsamer. „Shufkop“, ruft ein Polizist scharf ein Mischwort, das jeder versteht: „Kopf runter!“ und alle Männer senken ihre Köpfe zu den Knien. Als der Zug nach der Kurve beschleunigt, kommt der Ruf „Amen“, und die Köpfe heben sich wieder – wie nach einem Gebet. „Vorsichtsmaßnahme für Springlustige“, erklärt Hutchons.
Im Frauen-Abteil sind die meisten schon auf den Beinen. Die saftig-grünen Berge des Lebombo-Grenzgebietes ziehen am Fenster vorbei. Vor einigen Hütten brennt ein Feuer, Menschen gehen zur Arbeit. Die Polizisten witzeln mit denjenigen, die schon munter sind. Jeder scheint erleichtert, dass das Ziel näherkommt, obwohl die Abschiebung frustierend ist. Dann tauchen die hohen Stacheldrahtrollen auf, die sich über die Grenzhügel schlängeln. Flora zeigt auf den Zaun und schmeißt sich lachend in den Schoß ihrer Nachbarin. Eine letzte Zählung in Komatipoort auf südafrikanischer Seite bescheinigt den Rekord: Alle da! „Das ist noch nie vorgekommen“, sagt Hauptmann Hutchons. „Es springen manchmal bis zu 40 Leute. Aber heute haben alle Polizisten ihren Job gemacht.“ Das heißt, niemand hat Bestechungsgelder angenommen oder weggeschaut. Hatte doch der Vorgesetzte zudem am Anfang seine Leute auf Afrikaans gewarnt: „Wenn jemand springt, nicht schießen, die Presse ist an Bord.“
Der Zug rollt gegen zehn Uhr morgens im verschlafenen Ressano Garcia ein, dem ersten Grenzort auf mosambikanischer Seite. Beim Bahnhofsgebäude warten schon einige Familienangehörige mit Kleidung. Die ersten Geschäfte für den Rücktransport werden bereits wenige Minuten nach der Ankunft abgeschlossen. „He, wir sind noch vor dir zurück“, ruft einer frohlockend dem fast leeren Zug nach, der nur mit den – in Kürze betrunkenen – Polizisten besetzt wieder in Richtung Südafrika rollt. Mit dem Auto dauert die Rückfahrt schließlich nur sechs Stunden.
Gut eine Woche später: „Hello“, sagt Flora und kichert ins Handy. Dann spricht ihr Freund. „Hi, hier ist Eduardo“, sagt der 46-jährige Mann, der seit mehr als zwanzig Jahren in den Westonaria-Minen nahe Johannesburg arbeitet und wenig Geld verdient. Flora spricht kein Wort Englisch, er nur wenig. Wenn Flora Obst auf der Straße verkauft, geht es auch ohne viele Worte oder in afrikanischen Sprachen. Wie sie über die Grenze kam? Ganz einfach: In Ressano Garcia fragte sie bereits herum, wer die Taxifahrten organisiert. Eduardo beauftragte per Telefon Familienangehörige, sich um sie zu kümmern und machte Geld locker. Flora musste etwa 500 Rand (ca. 62 Euro) für die Fahrt bezahlen, Grenzübertritt ohne gültige Papiere inklusive. Pass und Visa in Mosambik dauerten zu lange, meinen die beiden, und seien noch teurer. Ihre beiden Kinder bleiben bis auf weiteres dort. „Was sollen wir machen – hier gibt es Arbeit.“
Martina Schwikowski ist Korrespondentin der Berliner tageszeitung für das südliche Afrika und lebt seit zehn Jahren in Johannesburg.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.