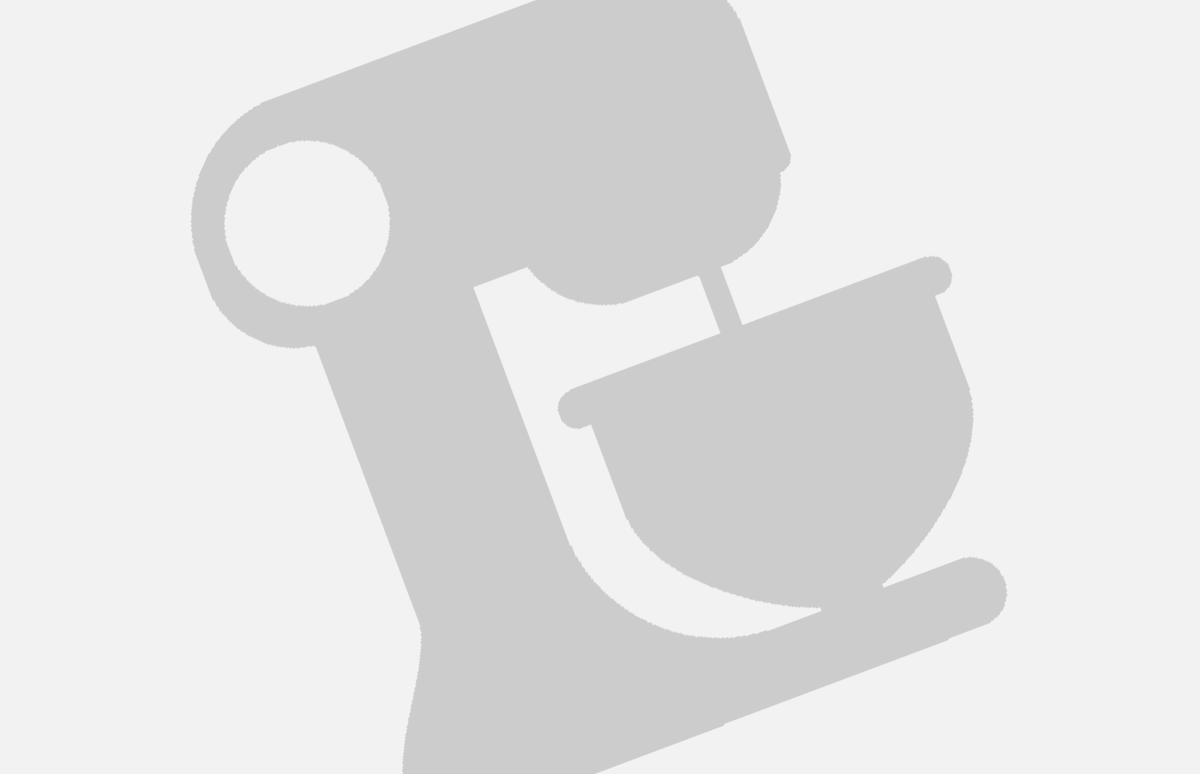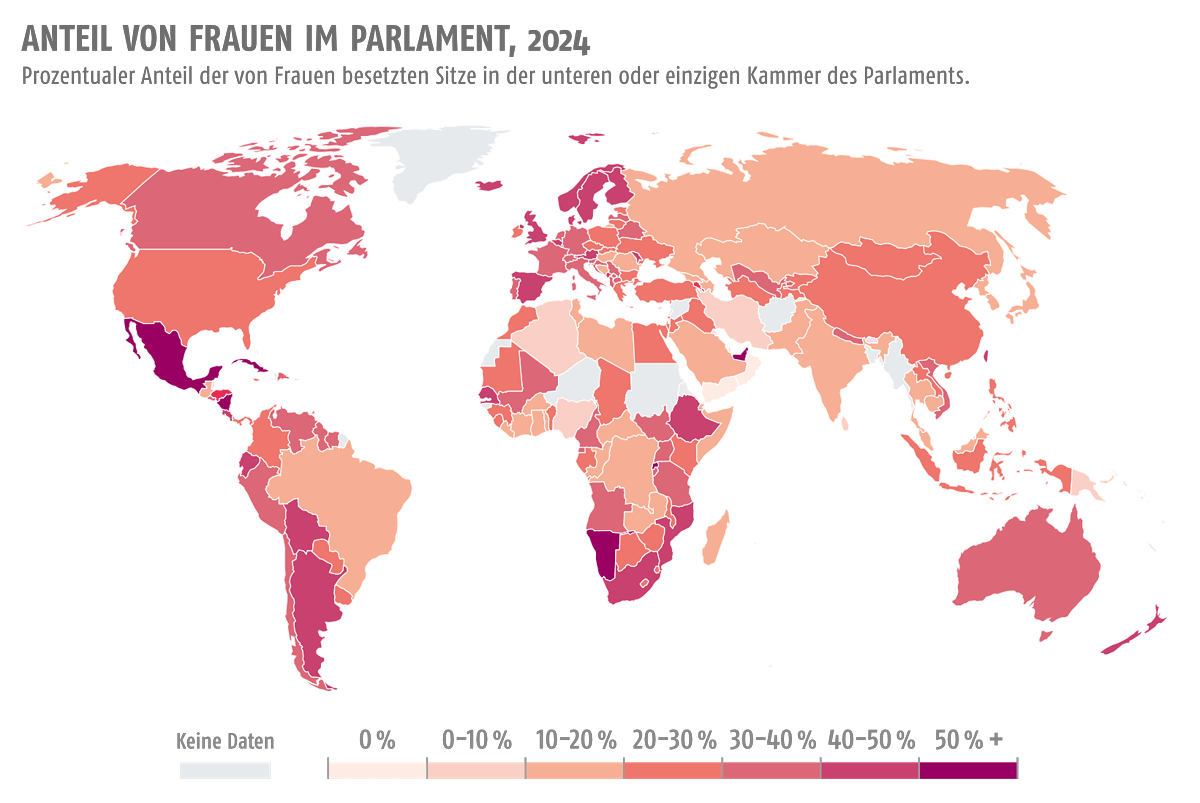
Das Ausbleiben der vorhergesagten Aids-Katastrophe in Uganda stellt die Grundannahmen über die Epidemie in Frage. Höchste Zeit, die Prioritäten in der Gesundheitspolitik zu überdenken, fordert Christian Fiala.
Heute liest man allerdings wenig über Aids in Uganda. Denn sämtliche Prophezeiungen haben sich als falsch erwiesen, wie die Ergebnisse der (alle zehn Jahre stattfindenden) Volkszählung vom September 2002 zeigen. Zusammenfassend meint das Statistische Zentralamt von Uganda: „Die Bevölkerung Ugandas wuchs zwischen 1991 und 2001 durchschnittlich mit 3,4% pro Jahr. Das starke Bevölkerungswachstum ist im wesentlichen bedingt durch die anhaltend große Fruchtbarkeit (7 Kinder pro Frau), welche wir seit 40 Jahren beobachten. Ferner hat auch der Rückgang der Sterblichkeit dazu beigetragen, welcher sich in der Abnahme der Säuglings- und Kindersterblichkeit widerspiegelt.“ In anderen Worten, das bereits sehr hohe Bevölkerungswachstum in Uganda hat sich in den letzten zehn Jahren noch weiter erhöht und liegt nun im weltweiten Spitzenfeld.
Wie ist dieser Widerspruch zu erklären, dass in einem totgesagten Land die vorhergesagte Katastrophe nicht nur ausgeblieben ist, sondern sich das Bevölkerungswachstum in dieser Zeit sogar dramatisch beschleunigt hat?
Häufig wird angeführt, das energische Eintreten der Regierung und der Hilfsorganisationen sowie die unzähligen Kampagnen gegen Aids hätten zu einer Änderung des Sexualverhaltens und deshalb zu einem Rückgang an HIV-Infektionen geführt. Diese Behauptung lässt sich jedoch nicht belegen – jedenfalls nicht anhand der Indikatoren zum Sexualverhalten in Uganda, wie die jüngste Haushaltsuntersuchung von 2001 zeigt. Folgende Indikatoren sind stabil, zum Teil seit 30 Jahren: die Fruchtbarkeit (7 Kinder pro Frau) sowie das durchschnittliche Alter von Frauen zur Zeit des ersten Verkehrs (16,7 Jahre), bei der ersten Heirat (18 Jahre) und bei der ersten Geburt (18,5 Jahre). Der einzige Indikator, der sich leicht verändert hat, ist der Anteil an verheirateten Frauen, die eine Verhütungsmethode anwenden. Er stieg in den letzten fünf Jahren von 18 auf 22% – immer noch sehr wenig im internationalen Vergleich. Und regelmäßig Kondome verwenden lediglich 2%. Es gibt also keinen verlässlichen Hinweis, dass sich das Sexualverhalten der Menschen in Uganda verändert hätte.
Tatsächlich ist die Erklärung anderswo zu suchen. Die Horrorszenarien beruhten auf der großen Zahl an Menschen mit einem positiven HIV-Test in Uganda. Die meisten dieser HIV-Positiven, so die Annahme, würden nach etwa acht bis zehn Jahren an Aids erkranken und in der Folge rasch sterben. Überraschenderweise hat jedoch die Sterblichkeit nicht zugenommen – diese Annahme war also offensichtlich falsch. Warum, legt eine Untersuchung von 1994 über die Zuverlässigkeit von HIV-Tests nahe: „ELISA und Western Blot [die am häufigsten verwendeten HIV-Tests] sind möglicherweise nicht ausreichend für die Diagnose einer HIV-Infektion in Zentralafrika.“ 1) Seither haben zahlreiche andere Studien diese Aussage und die Unzuverlässigkeit von HIV-Tests bestätigt. Besonders in Afrika haben die Menschen viele Antikörper gegen Krankheitserreger oder Fremdeiweiß nach Blutspenden oder unsauberen Injektionen. Einige dieser Antikörper können zu einem falsch-positiven HIV-Test führen. Da diese Menschen zwar einen positiven HIV-Test haben, jedoch nicht mit HIV infiziert sind, sterben sie auch nicht nach der angegebenen Zeit.
Nicht nur die Zahlen über HIV-Infektionen sind unzuverlässig und irreführend, sondern auch offizielle Aids-Statistiken. Die Diagnose von Aids basiert auf einer eigenen Definition für Entwicklungsländer („Bangui-Definition“), welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1985 beschloss. Danach wird Aids aufgrund von unspezifischen Krankheitssymptomen und ohne einen HIV-Test diagnostiziert. Noch heute werden in Uganda und anderen afrikanischen Ländern Menschen mit anhaltendem Durchfall, Fieber und Juckreiz zu Aidskranken erklärt. Aber auch die typischen Symptome für Tuberkulose – Fieber, Gewichtsverlust und Husten – gelten offiziell als Aids, auch ohne HIV-Test.
In der Zentrale der WHO in Genf werden zu den gemeldeten Aids-Kranken dann vermutete Fälle dazugezählt, um zu einer Gesamtschätzung zu kommen. So verkündete die WHO im November 1997, es gäbe seit dem vorherigen Bericht vom Juli 1996 etwa 4,5 Millionen mehr Aids-Fälle in Afrika. In diesem Zeitraum waren jedoch nur 120.000 Aids-Kranke tatsächlich auch gemeldet worden. Mit anderen Worten, 97% der angeblichen neuen Aids-Fälle waren erst in der WHO-Zentrale in Genf entstanden (siehe Tabelle). Dieser Absurdität geht die WHO seither aus dem Weg, indem sie die Statistiken anders aufbereitet. Nun werden gesunde Menschen mit einem positiven HIV-Test gemeinsam mit Aids-Kranken in den WHO-Statistiken geführt.
Der auf dieser irreführenden Basis geführte Kampf gegen Aids hat jedoch fatale Konsequenzen. So empfahl etwa UNAIDS 1999 den Wirtschaftsministern afrikanischer Länder, die Budgets für Soziales, Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur und ländliche Entwicklung zu kürzen, um mehr Mittel für den Kampf gegen Aids zur Verfügung zu haben. Und wenn allein in Uganda 4.000 Hilfsorganisationen im Kampf gegen Aids aktiv sind (Stand 1994), ist klar, wie die Prioritäten im Gesundheitssystem gesetzt werden. Ohnmächtig kommentierten ugandische Autoren: „Weil lokale Entscheidungsträger derart abhängig von Spenden sind, neigen sie dazu, Hilfsprojekte wahllos zu akzeptieren.“
Andere Probleme werden im Kampf gegen Aids stark vernachlässigt. So hat ein großer Teil der Bevölkerung Ugandas keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser: Im Jahr 1990 waren es 56%. Zehn Jahre und Millionen Dollar an Spenden später waren es immer noch 50%. Besonders zynisch ist die Situation z.B. in Kyotera, einer Stadt des Rakai-Distrikts. Dort wird besonders viel Geld im Kampf gegen Aids ausgegeben, weil dieser Distrikt angeblich am stärksten von der Epidemie betroffen ist. Trotz Millionen von Hilfsgeldern, Kampagnen für Abstinenz und verteilter Kondome müssen die Menschen von Kyotera ihr Trinkwasser immer noch von einem ungeschützten Wasserloch holen und sich dieses noch mit den Weidetieren teilen.
Auch die Müttersterblichkeit in Uganda ist eine der höchsten der Welt und hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verringert. Nach wie vor stirbt eine von 17 Frauen während ihrer fruchtbaren Lebensjahre. Ein Hauptgrund dafür sind die Folgen von illegalen Schwangerschaftsabbrüchen, ein zweiter ist das Fehlen des wichtigsten Medikamentes in der Geburtshilfe: Prostaglandine werden in aller Welt angewendet, und es gibt auch ein sehr gutes und billiges Präparat. Aber in Afrika ist dieses lebensrettende Medikament nur in drei Ländern zugelassen. Uganda gehört erst seit letztem Herbst dazu.
Währenddessen fahren Aids-ExpertInnen in allradgetriebenen klimatisierten Autos durch das Land, wenn sie nicht gerade in ihren komfortablen Büros die Welt vor Aids retten oder auf einem Kongress im Ausland ihre neuesten Medikamentenversuche an AfrikanerInnen vorstellen. Die Regierung hat nicht nur für viele Millionen Dollar Kondome auf Kredit gekauft, sondern borgt sich von den Industrieländern noch mehr Geld, um ungenaue HIV-Test und toxische Aids-Medikamente kaufen zu können. Bisher erst vereinzelt melden sich Stimmen gegen diese manchmal auch als zynisch verstandene Unausgewogenheit. So schrieb ein Leser der Tageszeitung New Vision in Kampala: „Die meisten Menschen sterben an Malaria, gebt uns deshalb kostenlose Moskitonetze anstelle von Kondomen und Aidsmedikamenten.“
Um Bilanz zu ziehen: Die Aids-Hysterie der letzten 20 Jahre war zwar politisch korrekt, führte aber zu einer Vernachlässigung anderer weit wichtigerer Aspekte im Gesundheitswesen. Leider hat das Engagement gegen Aids nicht nur viel Geld gekostet, sondern war auch zum Nachteil der Menschen in Afrika. Profitiert haben die unzähligen westlichen NGOs, internationale Organisationen und Aids-Experten. Nun ist Irren menschlich. Allerdings muss eine Politik, die auf offensichtlich falschen Annahmen beruht und vornehmlich negative Auswirkungen für die Betroffenen hat, verworfen oder angepasst werden. Ein Festhalten führt zu Fragen nach der Verantwortung der Entscheidungsträger. Es stellt sich deshalb immer dringender die Frage, wann die derzeitige Politik überdacht und den Prioritäten der Menschen in Afrika angepasst wird.
Christian Fiala ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und seit 15 Jahren engagiert in der Diskussion über die Ausbreitung von HIV/Aids. Im Jahr 1997 erschien zum Thema HIV sein Buch „Lieben wir gefährlich?“ (Deuticke Verlag Wien). Er ist Mitglied der Expertenkommission des südafrikanischen Präsidenten zu HIV/Aids. Im vergangenen Jahr arbeitete er im Mulago Hospital in Kampala, Uganda.
1) The Journal of Infectious Diseases, 1994; 169: 296-304.
Eine Literaturliste kann beim Autor bezogen werden.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.