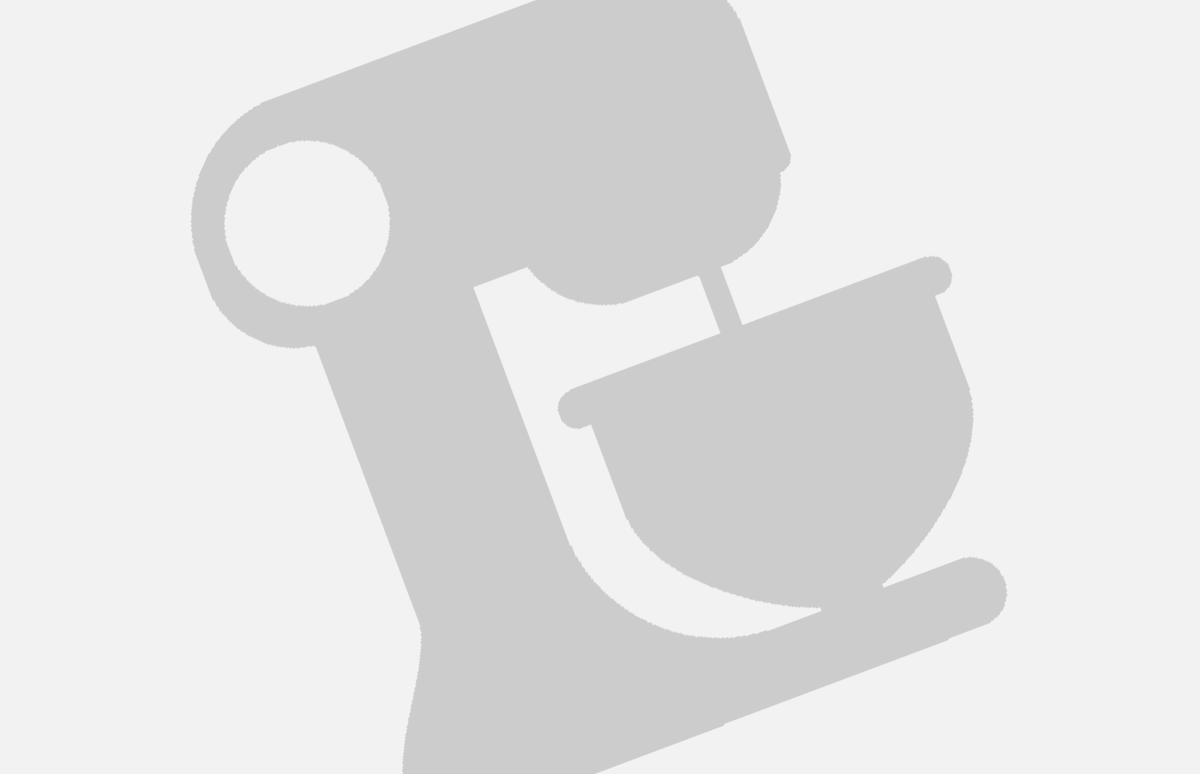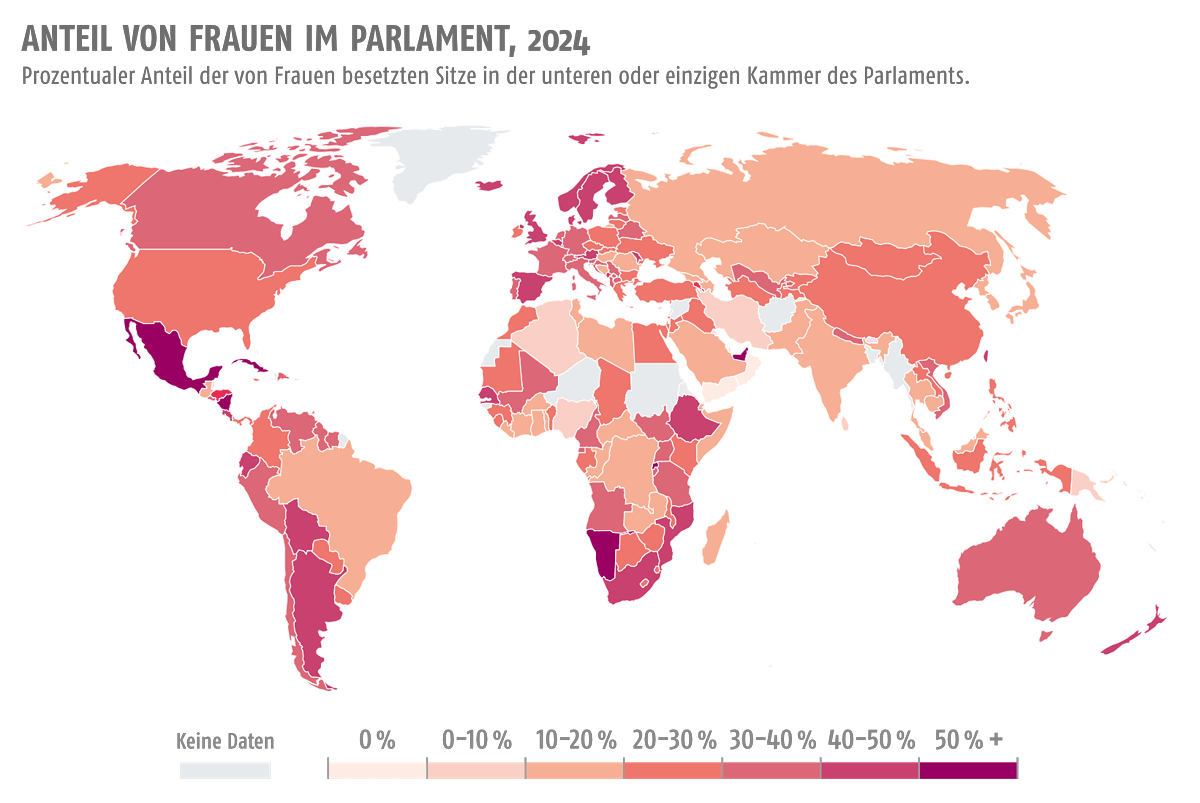
60.000 afrikanische AsylwerberInnen befinden sich in Israel, kaum jemand von ihnen hat die Chance, als Flüchtling anerkannt zu werden. Ihre Zukunft ist ungewiss, in der öffentlichen Debatte wird gegen sie gehetzt.
Blessing Akchaukwu ist müde. Müde, sich wieder erinnern zu müssen. An die eine Aprilnacht, in der um zwei Uhr Früh der Vorhof ihrer Wohn- und Arbeitsstätte plötzlich in Flammen stand und Flaschenscherben über den ganzen Boden verstreut waren. Sie kennt nicht einmal das Wort für die Ursache: Molotow-Cocktail. Im Zuge von Anti-Asylwerber-Demonstrationen in Tel Aviv kam es zu Anschlägen, auch auf den von ihr geleiteten Kindergarten für Kinder afrikanischer AsylwerberInnen.
In der israelischen politischen Debatte ersetzt der Begriff des „Eindringlings“ meist den des Asylwerbers. Anfang des Jahres änderte die Knesset ein Gesetz, das nun die Inhaftierung von so genannten illegalen MigrantenInnen für bis zu drei Jahre ermöglicht. Damit wird das Ansuchen um Asyl kriminalisiert. Ein Gefängnis für bis zu 11.000 Personen wird derzeit in der Negev-Wüste errichtet, Ende des Jahres soll es fertig gestellt sein. Kurzfristig war geplant gewesen, innerhalb der Gefängnismauern auch Zelte zu errichten und somit Platz für 30.000 Häftlinge zu schaffen – das ging aber nicht durch.
Insgesamt 60.000 AsylwerberInnen befinden sich in Israel, der Großteil von ihnen stammt aus Eritrea. Das ostafrikanische Land, das seit 1993 von Äthiopien unabhängig ist, wird autoritär regiert und belegt im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen den letzten Platz. Zusammen mit der zweitgrößten Gruppe, den SudanesInnen, bekommen EritreerInnen den Status der „temporary group protection“ zugesprochen. Damit wird ihnen ein Aufenthaltsrecht verliehen, das alle drei Monate erneuert werden muss. Eine Einzelfallprüfung findet nicht statt. Generell existiert ein Arbeitsverbot, die Nicht-Einhaltung wird aber nach einem Entscheid des Obersten Gerichtshofs bis zur Fertigstellung des Gefängnisses nicht geahndet. Derzeit steht trotzdem „keine Arbeitserlaubnis“ auf den ausgestellten Visa. Die Unsicherheit unter AsylwerberInnen und ihren (potenziellen) ArbeitgeberInnen ist daher groß.
Die Knesset-Abgeordnete Miri Regev (Likud-Partei) bezeichnete während einer Anti-Flüchtlingsdemo im Mai die SudanesInnen als „Krebs in unseren Körpern“. Im Zuge der Demonstration wurden AfrikanerInnen auf offener Straße angegriffen.
Der Levinsky-Park im Süden von Tel Aviv ist inzwischen zum Symbol der Problematik geworden. Er ist Sammelpunkt vieler AsylwerberInnen, die hier gelangweilt und wartend den Tag verbringen. Eine lokale Organisation hat eine kleine Bibliothek eröffnet, Freiwillige beschäftigen sich mit den Kindern. Am Abend gibt es Ausspeisungen, viele schlafen im Park – auf Kartons in der Wiese, in der Rutsche am Kinderspielplatz, auf den metallenen Sonnenschutzdächern, die über den Sitzbänken angebracht sind.
Nach ihrer Ankunft in Israel bekämen AsylwerberInnen ein One-Way-Ticket nach Tel Aviv, „fallen aus der Busstation in den Levinsky Park und dann sind sie einfach da“, erzählt Marie Kienast von der Organisation African Refugee Development Center (ARDC). Ohne staatliche Unterstützung oder die Chance, als Flüchtlinge anerkannt zu werden, beginnt für sie ein Leben im Schwebezustand. Bis Mitte 2009 wurden Asylanträge vom UNHCR bearbeitet. Danach stieg die Zahl der AsylwerberInnen und das israelische Innenministerium übernahm den Prozess der Flüchtlingsfeststellung. In den letzten drei Jahren wurden nur 16 Asylanträge genehmigt. Insgesamt wurden seit Staatsgründung im Jahr 1948 weniger als 200 Flüchtlinge offiziell anerkannt.

Kidane Isaac, der selbst vor zwei Jahren in Israel ankam, ist einer von acht gewählten VertreterInnen der eritreischen Community in Tel Aviv. Die Selbstorganisation sei nicht einfach, Unterstützung gebe es wenig, sagt er und kritisiert damit auch die NGOs, die sich für die Flüchtlinge engagieren. An diesem Septembertag nimmt der 26-Jährige an einer feierlichen Eröffnung eines neuen Kindergartens teil. Da die Gebühren für israelische Kindergärten für AsylwerberInnen nicht zu bezahlen sind, müssen Community-intern Projekte finanziert werden. EritreerInnen haben Geld zusammengelegt und eine Jahresmiete für die neue Einrichtung finanziert. Auch Blessing Akchaukwus Kindergarten ist so ein Projekt.
Isaac floh 2007 aus Eritrea nach Libyen und scheiterte insgesamt sieben Mal beim Versuch, mit Schmugglern nach Italien zu gelangen. Einmal endete es beinahe tödlich: Der Motor des Schlauchboots setzte nach einer Stunde Fahrt aus. Doch Fischerboote in der Nähe nahmen die Flüchtlinge auf und brachten sie zurück an die libysche Küste. Aber selbst Flüchtlingsboote, die bereits internationale Gewässer erreicht hatten, wurden damals von Frontex-Truppen illegal in libysche Gewässer zurückgedrängt, wie ein Human Rights Watch Report aus 2009 ausführt.
Erst 2010 beschloss Isaac, nach Israel zu flüchten. Einen Monat dauerte die Reise durch Ägypten und den Sinai. Durch Eritreer, die bereits nach Israel gelangt waren, wusste er, welchen Schleppern er vertrauen konnte. Es existieren zahllose Berichte von Morden, Folterungen, Vergewaltigungen und Entführungen mit Lösegeldforderungen bis 50.000 US-Dollar durch Beduinen im Sinai. Die Organisation ARDC in Tel Aviv betreibt ein Frauenhaus, einige der dort untergebrachten Frauen sind nach Vergewaltigung auf der Flucht schwanger. „Physicians for Human Rights“ listen auf ihrer Website Zeugnisse von Betroffenen auf, die in Ketten gelegt nach monatelanger Gefangenschaft in Kellern überlebt hatten. Al Jazeera berichtete darüber, und Human Rights Watch veröffentlichte am 5. September einen Bericht mit der Forderung an Ägypten, alle übrigen entführten MigrantInnen zu befreien.
Kidane Isaac hatte Glück, seine Schlepper brachten ihn sicher über die Grenze. 3.000 Dollar verlangen sie pro Kopf. Die Gruppe umfasste 16 Personen, auch zwei Frauen mit Kindern. Kaum auf der israelischen Seite angekommen wurde Isaac tagelang inhaftiert und danach wie alle seiner Landsleute mit einem Busticket nach Tel Aviv entlassen.
Dort lebt er heute und engagiert sich für seine Community. Doch eine „temporary group protection“ bietet eben keinen sicheren Anspruch auf Aufenthalt. Das mussten viele SudanesInnen am eigenen Leib erfahren. Im Juli 2011 erklärte sich der Südsudan unabhängig und Israel beeilte sich, den neuen Staat als sicheres Rückkehrland einzuschätzen. Die neuen SüdsudanesInnen verloren ihren Gruppenschutz und wurden vor die Wahl gestellt: Freiwillige Rückkehr bis 31. März 2012, unterstützt vom Staat mit 1.000 Euro, oder Deportation. Das erste Flugzeug nach Juba, der Hauptstadt des Südsudan, hob am 17. Juni ab.
Ende August 2012 forderte der israelische Innenminister Eliyahu Yishai, von der ultraorthodoxen Shas-Partei, eine endgültige Deportation aller EritreerInnen und SudanesInnen. Nach dem 15. Oktober müssten alle mit Inhaftierung und Deportation rechnen. „Ich werde alles tun, um ihr Leben elend zu gestalten“, verlautbarte er. Nachdem Menschenrechtsgruppen vor Gericht gezogen waren, verhängte ein Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Verhaftungen. Ängstlich warteten die afrikanischen Communities auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, bis es erst Ende Oktober hieß, dass die Aussage des Innenministers vorerst eine leere Drohung gewesen sei. Er habe nie offizielle Anweisungen zu Massenverhaftungen gegeben.
Einen Monat davor war eine Gruppe von 21 EritreerInnen zwischen den ägyptisch-israelischen Grenzzäunen gefangen gewesen. Zwei Frauen, eine hatte eine Fehlgeburt erlitten, und ein Kind wurden nach acht Tagen auf die israelische Seite gelassen. Der Rest der Gruppe wurde nach Aussagen der drei inhaftierten EritreerInnen mit Eisenstangen und Tränengas nach Ägypten zurückgedrängt. Ihr Verbleib bleibt unklar.
Um weitere „Eindringlinge” abzuhalten, wird derzeit ein 266 Kilometer langer Grenzzaun zu Ägypten fertig gestellt, ein 200 Millionen Euro-Projekt. Zu viele kämen sonst in das kleine Land mit seinen acht Millionen EinwohnerInnen, so die Argumentation. Das politische Problem wird oft nicht an der afrikanischen Herkunft der AsylwerberInnen festgemacht, sondern an der Tatsache, dass sie keine Juden sind. Premier Benjamin Netanjahu sieht die jüdische Identität Israels gefährdet. Eine Minderheit weist auf die internationalen Verpflichtungen Israels hin und betont, dass gerade dieses Land das Leid von Flüchtlingen nicht ignorieren dürfe. Ein Asylwerber aus Darfur schloss einen Appell in der Zeitung Haaretz mit den resignierenden Worten: „Ich weiß, dass ich hier niemals die gleichen Rechte erlangen werde – ich möchte auch nur die wenigen Rechte, die mir als Flüchtling zustehen.“
Benjamin Breitegger studiert Politikwissenschaft in Wien. Im August und September diesen Jahres besuchte er Israel.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.