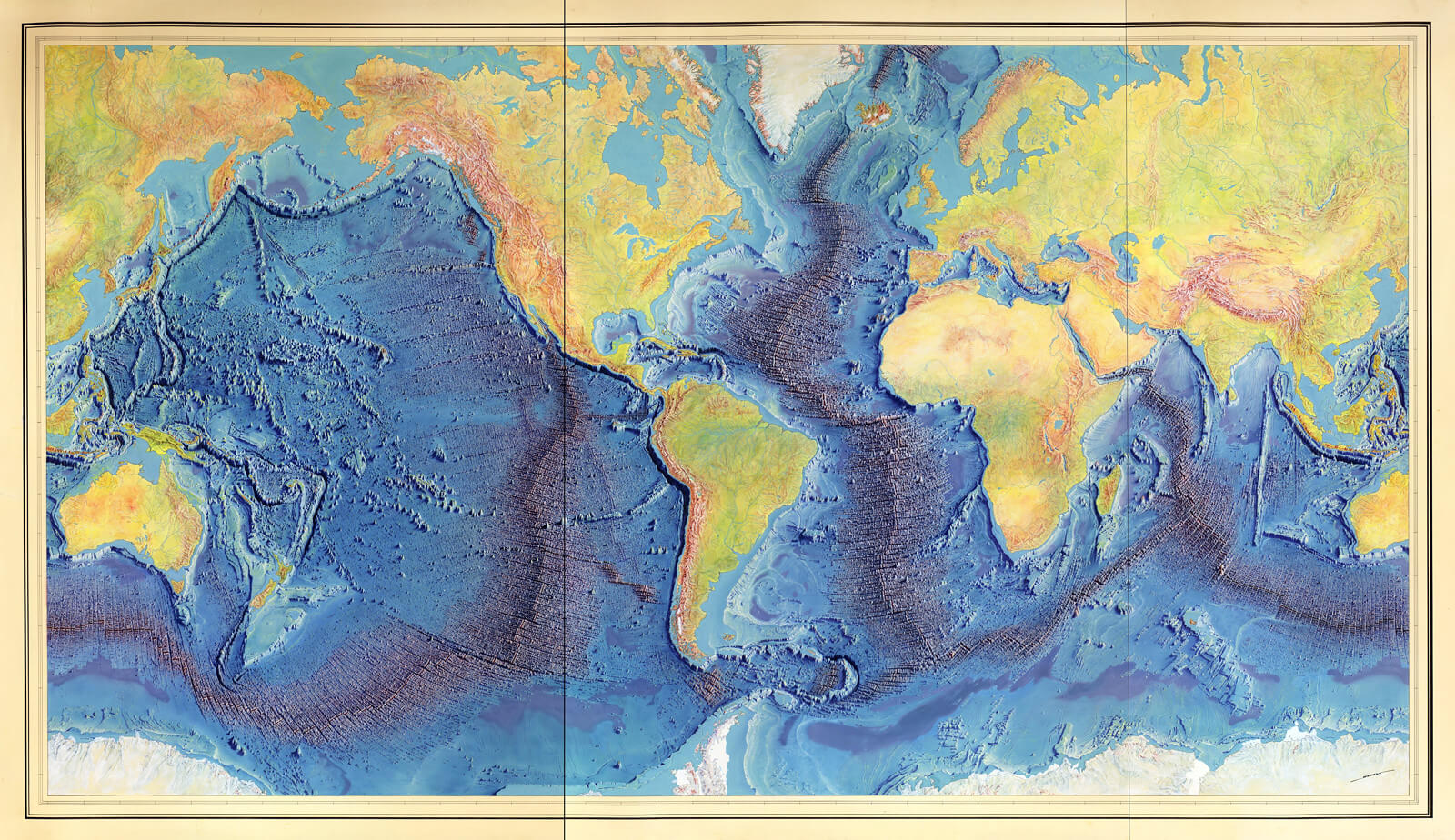Der nervtötende Lärm des Autoverkehrs und das Rufen der StraßenhändlerInnen bricht sich an den Wänden trostloser Wohnblocks. Wir stehen vor der Endstation der U-Bahn in El Valle im Süden von Caracas. Mittels Mobiltelefon machen wir Cletalina Noeman in der Menge ausfindig, eine kräftige, energiegeladene Frau, die unsere Führerin sein wird. Nach ein paar Knochen brechenden Minuten in einem Bus steigen wir bei einer aufgelassenen Tankstelle aus, früher ein Treffpunkt von Drogenhändlern und Dieben, sagt Cletalina.
Hinter der Tankstelle erhebt sich ein enormes Bauwerk, ein Labyrinth aus Ziegelmauern, Wellblech, Stacheldraht, Brettern und Bauschutt, durchsetzt mit vereinzelten, hell verputzen Flächen. Der Gesamteindruck ist der eines riesigen, ziegelfarbenen Bienenstocks. Neben der Tankstelle beginnt ein Weg. Wir folgen ihm aufwärts, bis wir zu einem verschlossenen Tor gelangen, eingesetzt in eine weiß getünchte Mauer. Dahinter erstreckt sich ein ebener Pfad zwischen einer Reihe von Holzbaracken, die mich vage an Tombstone erinnern, die alte Westernstadt in Arizona. An seinem Ende, umrankt von Blumen, befindet sich das, was durchaus einmal der Saloon gewesen sein könnte.
Eine vielköpfige, lärmende Familie heißt uns willkommen. Ich werde eingeladen, mich neben Amador Villareal zu setzen, den Familienältesten. Er sagt mir, dass sie alle erst seit knapp mehr als einem Jahr hier leben. In dieser Zeit haben sie das Fundament gelegt und das Holzhaus errichtet, Strom, Wasser, und Abwasser angeschlossen, Küche und Badezimmer eingerichtet und einige imposante Möbelstücke herbeigeschafft; es gibt sogar einen Herrgottswinkel für die Heilige Jungfrau Maria. Das alles wurde möglich, sagt Amador, weil sie zusammen mit vielleicht 200 Nachbarn ein ungenutztes Grundstück besetzt haben. Auf Basis der neuen Gesetze, die unter Chávez zur Regulierung des städtischen Grundbesitzes beschlossen wurden, können sie nun einen Eigentumstitel für ihr Haus beanspruchen. Niemals zuvor in seinen 82 Jahren habe er sich besser gefühlt, meint Amador.
Inmitten von Gelächter und Einladungen, sie wieder zu besuchen, gehen wir weiter. Verläuft der Weg eben, haben wir die Dächer auf der einen Seite und die Erdgeschosse auf der anderen, so steil ist der Hang. Wir sehen uns ein paar andere Häuser an. Eines ist voller Lebensmittel – der „Mercalito“ des Viertels, eine Filiale der staatlichen Ladenkette Mercal, die konkurrenzlos billige Lebensmittel verkauft. Ein anderes beherbergt einen lustlosen Papagei, einen Satellitenfernseher und eine Geburtstagstorte. Einige der Häuser sind solide, regelrechte Villen, bewacht von bissigen Hunden, andere bloß leere Ruinen.
Wir kommen zu einem Betonstreifen, der den steilen Hang hinaufführt. Es ist eine Straße. Jeeps, knapp vor dem Umkippen, befördern Fahrgäste von der nächsten Bus- oder U-Bahnstation hinauf und wieder hinunter. Sie verraten die innere Struktur des Bienenstocks. Je höher man kommt – und wir sind noch lange nicht ganz oben – desto näher ist man dem unteren Ende seiner sozialen Hierarchie und Leuten wie denen, die früher die verlassene Tankstelle unten in Beschlag nahmen. Caracas, heißt es, hält den Weltrekord in punkto bewaffneter Kriminalität pro Kopf, und ein Gutteil davon spielt sich hier ab.
Auf der anderen Straßenseite, auf einem Vorsprung des Hügels, steht ein achteckiges Gebäude, das an eine chinesische Laterne erinnert. Solche Gebäude gibt es in allen Barrios der Stadt. Es soll ein lokaler Gesundheitsposten werden, aber der hier ist noch umzäunt und leer. Dann betreten wir ein Haus, das sich zum Gasthaus oder eher der „Volksküche“ des Barrio entwickelt hat. Eine Frau mit leiser Stimme, die uns ihre Arbeit genauestens erklärt, ist gerade am Kochen. Jeden Tag werden hier vielleicht 200 Menschen gratis verköstigt, die andernfalls hungern würden. Indem die Gemeinschaft dafür sorgt, dass es keinen Hunger gibt, überwindet sie ihre eigenen Schwächen, wird uns erklärt.
Weiter oben an der Betonstraße nehmen wir wieder einen Weg, der parallel zum Hang verläuft, rund um ein brummendes Pumpenhaus, errichtet von der Mesa de Agua, dem „Wasserkomitee“ des Viertels. Der Weg ist gepflastert und peinlich sauber. Vorbei an Kindern auf Klettergerüsten und Teenagern, die Tanzschritte üben, erreichen wir das Haus von Franklin Machadao.
Sein Haus ist geräumig und bietet – wie viele hier im Barrio – eine prächtige Aussicht auf das Gewirr der Straßen in der Ebene, die letzten Ausläufer der Stadt und die bewaldeten Hügel dahinter. Die eine Hälfte des Raums ist voller Lattenkisten, die er bei seiner Arbeit braucht – er verkauft gesalzene Bananenchips. In der anderen gibt es Sessel, eine große Küche, wo er gerade Kaffee kocht, ab und zu abgelenkt von klagenden Rufen seiner Mutter aus dem Obergeschoss. Franklin besucht seit einiger Zeit Kurse der Misión Ribas, einem Erwachsenenbildungsprogramm, wofür er auch einen kleinen Zuschuss erhält.
Er und Cletalina machen es sich bequem, um mir die Welt aus ihrer Perspektive zu beschreiben. „Man könnte sagen, die Bolivarianische Revolution beginnt ganz von vorn“, sagt Franklin, „um das aufzubauen, was eigentlich von Anfang an geschehen hätte sollen – ein freies Amerika, ein Venezuela, das sich zum Vorteil aller entwickelt und nicht nur einiger weniger … Nehmen wir einmal den Machismo, diese Art von Gedankenlosigkeit, die hier genauso verbreitet war wie anderswo auf dem Kontinent. Am männlichsten ist heute nicht unbedingt der, der die meisten Kinder hat, am meisten trinkt oder die schwersten Gewichte hebt. Es ist der, der sich seiner Verantwortung bewusst ist für das, was rund um ihn passiert, für seine Familie und seine Gemeinschaft.“
„Wir Leute aus den Barrios, die an diesen Problemen arbeiten“, sagt Cletalina, „werden oft von Außenstehenden angegriffen. Und weißt du warum? Weil sie nicht wollen, dass wir tun, was wir tun müssen, nämlich uns zu organisieren.“ „Wir haben die ganzen Manipulationen der Vierten Republik (die Ära vor 1998; Anm.) nicht durchgemacht, nur um uns wieder politisch manipulieren zu lassen“, betont Franklin. „So wie ich das sehe, nutze ich die neuen Chancen nicht nur für mich, sondern für die ganze Gesellschaft – für ein besseres, menschlicheres Leben.“
„Es ist viel Bewusstsein geschaffen worden“, setzt Cletalina fort. „Es ist nicht mehr wie früher, als die Leute sagten: ‚Was mir gehört, gehört mir, und was dir gehört, gehört auch mir.’ Es gab viel Egoismus, Selbstsucht. Das wird langsam besser. Wenn etwas ‚da draußen‘ passiert, dann ist es nicht mehr das Problem ‚von denen‘, es betrifft uns alle. Deshalb haben wir uns auch am Weltsozialforum vor kurzem hier in Caracas beteiligt.“
„Ich habe 15 Jahre lang für Privatunternehmen gearbeitet“, erklärt Franklin. „Die gesellschaftlichen, politischen Aspekte haben mich überhaupt nicht interessiert. Dann kam der Caracazo (1989; Anm.). Das hat die Einstellung vieler Venezolaner verändert. Leute wie wir erkannten, dass wir uns Lügen auftischen ließen – all diese neoliberalen Reformen, die angeblich gut für das Land waren, aber schlecht für uns. Was ich gelernt habe, hat mein Verhalten verändert, meine Art zu denken. Wir bauen langsam ein neues Leben auf.“
Und weiter: „Sowohl Chávez als auch die Opposition behaupten, für alle Venezolaner zu sprechen. Aber jeder Venezolaner denkt anders. Ich kann nicht sagen, dass alle Chávez unterstützen, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Aber die, die es tun, die an der Basis, die wollen, dass er weitermacht. Aber täusch dich nicht: Wenn Chávez sich zum Schlechten verändert, dann werden wir ihn loswerden.“
Später, vor dem Haus Cletalinas, treffe ich auf Carmen Sulabeira, eine überraschend attraktive Frau in den Siebzigern. Ihr winziges Haus ist mit Gesundheitspostern, Medikamenten und einer Couch für die Nachbarschaftspraxis voll gestopft. Wie viele andere, sagt sie, hat sie erfahren, wie viel es bedeuten kann, von der Gemeinschaft für einen Dienst geschätzt zu werden, den man ihr leistet.
Hinter einem Vorhang lebt ein kubanischer Arzt, der gerade nach Hause kommt. In aller Ruhe spricht er über die chronischen Krankheiten, Grippe, Fieber, Asthma und die Infektionen, an denen seine PatientInnen leiden. Er hat nun fast drei Jahre hier gelebt und gearbeitet, und er vermisst seine Familie sehr. Aber er kann sich keine bessere Möglichkeit vorstellen, seine Fähigkeiten anzuwenden, und er kennt keine Gemeinschaft, die sie mehr benötigt und dankbarer dafür ist.
Wir gehen wieder hinunter, an der Tankstelle vorbei, in den Bus, in die U-Bahn und raus in die von Autos verstopften Straßen im Zentrum von Caracas, vorbei an den elektrischen Zäunen und Iris-Erkennungsystemen, und all das kommt uns plötzlich vor wie ein versteinertes Ghetto.
Copyright New Internationalist