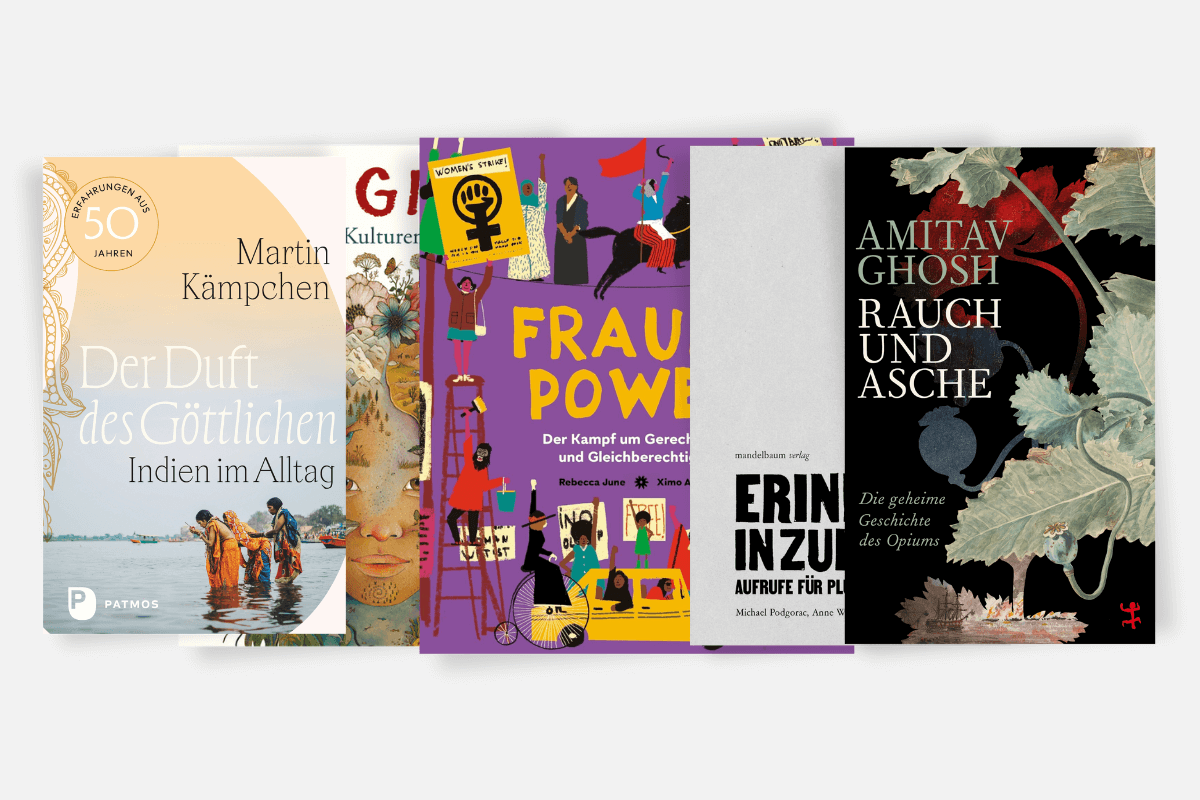
Kapital im Kopf
Nach dem neoliberalen Messianismus wird nun „Wissen teilen“ zum neuen Leitbild in Sachen Entwicklung. Wie Machtverhältnisse geändert werden können, steht dabei nicht auf dem Lehrplan.
Tatsächlich ergibt eine allgemeine Bewertung der Entwicklungsländer nach „Wissensindikatoren“ ein deprimierendes Resultat: Die Wissenskluft zu den reichen Ländern ist noch weit größer als die zwischen ihren wirtschaftlichen Leistungen. Sie stellten 1995 zwar mehr als vier Fünftel der Weltbevölkerung und 42,5 Prozent des Weltwirtschaftsprodukts, schätzt die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), aber nur 14,5 Prozent der Ausgaben für Forschung & Entwicklung (F&E), knapp 13 Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen und jeweils nur rund ein Prozent der in den USA bzw. der Europäischen Union registrierten Patente.
Von „Wissen für Entwicklung“ zu reden, wie etwa die Weltbank ihren Weltentwicklungsbericht 1998 nannte, gewinnt dadurch eine besondere Dringlichkeit, die an die Angst der Anleger erinnert, den Börsegang eines neuen Internet-Unternehmens zu verpassen: Welches Land nicht rasch genug am neuen Informations- und Wissensuniversum des World Wide Web teilhat, dem droht ein schwer wiegender Konkurrenznachteil, und „Wissen“ wird vorrangig zu einer ökonomischen, positiv besetzten Kategorie.
Welche Rolle das Internet für die Entwicklung spielen könnte und sollte, war bereits Thema der internationalen „Global Knowledge Conference“ in Toronto (1997) und in Kuala Lumpur (März 2000). Die Themen in der malaysischen Hauptstadt – „Access, Empowerment, Governance“ – sind ein Ausdruck der mit dem Internet verbundenen Hoffnungen auf Zugang zu Wissen, eine Überwindung der Machtlosigkeit und mehr Demokratie und Transparenz . Was jedoch auffällt, ist der naive Umgang mit dem Begriff Wissen: „Wissen ist mächtiger, wenn es geteilt wird“, lautet etwa ein Motto des „Global Knowledge Partnership“, einer von der Weltbank geförderten Organisation An dieser sind neben zahlreichen NGOs auch bekannte Unternehmen wie Cisco, Sun Microsystems und PricewaterhouseCoopers beteiligt.
Warum naiv? Wissen wird hier völlig neutral verstanden – als „Humankapital“, das im Unterschied zu anderem Kapital wie Geldvermögen, Land oder Maschinen weitergegeben werden kann, ohne seinen Wert für den ursprünglichen „Inhaber“ zu verlieren, und dabei in einer Art Schneeballeffekt immer größere Wirkungen entfaltet. Dass das ebenso für falsches Wissen oder Gerüchte zutrifft, mit möglicherweise fatalen Folgen, wird aber ebenso ausgeblendet wie die Funktion von Wissen als Konkurrenzvorteil im Wettbewerb oder als Herrschaftsinstrument.
Auch weiter oben, in den Kreisen der Entscheidungsträger. Dass sich Wissen und Macht wechselseitig verstärken, sei ein Aspekt, der oft unter den Tisch falle, betont Rubens Ricupero, UNCTAD-Generalsekretär in seinem Bericht an die letzte UN-Konferenz für Handel und Entwicklung im Februar in Bangkok. Eben deshalb werde Wissen durch politische und wirtschaftliche Macht geschützt, ein Trend, der sich mit den jüngsten multilateralen Verhandlungen „deutlich verstärkt“ habe – ein Hinweis auf den internationalen Patentschutz durch das TRIPS-Abkommen. Es wäre eine „perverse Ironie“, so Ricupero, wenn der Zugang zu Wissen genau dann zunehmend beschränkt würde, wenn die Revolution in der Telekommunikation den physischen Fluss von Information erleichtere: Denn „Wissen darf kein Monopol werden, sondern eine zugängliche und befreiende Kraft“.
Ricupero meint hier technisch-wissenschaftliches, allgemein anwendbares Wissen. Aber es gibt auch ein anderes „Wissen“, das den Entwicklungsländern nicht vorenthalten, sondern im Gegenteil „frei Haus“ geliefert und mit mehr oder weniger sanftem Druck zur Übernahme anempfohlen wird, nämlich wie sie ihre Wirtschaftspolitik auszurichten hätten. Und das ist – trotz einiger Relativierungen, etwa durch den (offenbar zu unorthodoxen) Ex-Chefökonomen der Weltbank, Joseph Stiglitz – nach wie vor der auch als neoliberales Glaubensbekenntnis verpönte „Washington Consensus“: Entscheidend sei es, in Menschen zu investieren, die Operationsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, Schranken gegen Handel und ausländische Investitionen abzubauen, Inflation und Staatsverschuldung zu bekämpfen und generell dem Staat bzw. Markt jeweils jene Aufgaben zu übertragen, die sie am besten bewältigen können.
Hier ist nicht der Platz, diesen „Konsens“ im Einzelnen zu diskutieren. Doch da gerade die Handelsliberalisierung zuletzt bei der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Seattle unter Beschuss geriet, ein kleiner Exkurs: Kann sich diese Forderung auf eine „gesicherte Erkenntnis“ der Wirtschaftswissenschaft stützen?
Einige empirische Studien in den 90er-Jahren schienen die These endgültig bewiesen zu haben. Doch im April 1999 wurde eine Analyse zweier Ökonomen (Rodriguez/Rodrik) veröffentlicht, die die erwähnten Studien methodologisch unter die Lupe und auseinander nahmen. Ihr Ergebnis: Es gibt keine schlüssigen Hinweise darauf, dass Länder mit niedrigeren Handelsbarrieren rascher wachsen als andere (aber auch nicht dafür, dass der Protektionismus ein Segen ist).
Der britische Economist fühlte sich zu einer Replik gezwungen, um die Fahne des Freihandels wenigstens rhetorisch hochzuhalten.
Genauso kam eine aktuelle Studie zweier Weltbank-Ökonomen (Lundberg/Squire) zu folgenden Schlussfolgerungen über die „Globalisierung“: Die globale Ungleichheit nimmt zu; überall klafft das Einkommen schlecht und gut Ausgebildeter immer weiter auseinander, und die Armen haben praktisch allein die Anpassungskosten zu tragen: Niedrigere Handelsschranken wirken sich durchwegs negativ auf die Einkommen der ärmsten 40 Prozent aus. Generell positiv sind die Effekte erst „langfristig“.
Nun gehört es aber bereits zum guten Ton, die Armutsbekämpfung zum zentralen Ziel der Entwicklungszusammenarbeit zu erheben, und die Weltbank beabsichtigt, ihre einschlägigen Erkenntnisse im kommenden Weltentwicklungsbericht 2000 zu präsentieren. Wie verträgt sich dies mit der etwa auch von der Europäischen Kommission geforderten Handelsliberalisierung?
Oder, ein weiteres Beispiel: Praktisch kanonisiert ist die Erkenntnis, dass wirtschaftliches Wachstum umso eher die Armut beseitigt, je geringer die Ungleichheit in einer Gesellschaft ist; ebenso ist bekannt, dass die Armut überall dort rasch abnahm, wo produktives Vermögen im Rahmen einer Landreform gerechter verteilt oder die Landwirtschaft durch ähnliche Maßnahmen angekurbelt wurde, in Japan, Taiwan und Korea sowie in China ab Ende der 70er-Jahre.
Aber wer fordert eine Landreform? Irgendwo befindet sich offenbar eine gut funktionierende Schranke gegen unbequemes Wissen. Wie ein Teilnehmer der laufenden E-Mail-Debatte über den geplanten Weltentwicklungsbericht 2000 erzählte, wurde vor einigen Jahren im US-Senat debattiert, ob die finanzielle Unterstützung der Regierung in El Salvador an die Durchführung einer Landreform geknüpft werden sollte. Schließlich besäße nur eine Hand voll Familien praktisch alles Land, während der Rest als Pächter arbeiten oder in die Städte abwandern müsse. Senator Jesse Helms (ein konservativer Republikaner) antwortete, sollten die USA eine Landreform in El Salvador fordern, müsste man dies auch in den USA tun, wo weniger als 2% der Bevölkerung mehr als 95% des in Privatbesitz befindlichen Landes kontrollieren.
Hält man sich die USA vor Augen, die weniger als fünf Prozent der Bevölkerung, aber mit zwei Millionen Menschen ein Viertel der Gefängnisinsassen der Welt stellen und dafür laut Washingtoner „Justice Policy Institute“ jährlich 40 Milliarden US-Dollar ausgeben, fällt es zwar schwer, darin eine der „fortgeschrittenen Gesellschaften“ zu erblicken, von deren „gesellschaftlichem Wissen“ Rubens Ricupero schwärmt: Sie hätten nicht nur gelernt, „reich zu werden, sondern auch politisch und wirtschaftlich stabiler und demokratischer, weniger gewaltanfällig und sozial ausgeglichener“. Wie Ricupero weiter meint, entstehe dieses Wissen „nur langfristig“ und werde doch „am dringendsten gebraucht“.
Insofern etwa auch in den westeuropäischen Gesellschaften so etwas wie soziale Ausgeglichenheit existiert, ist sie jedenfalls das Ergebnis jahrzehntelanger politischer und sozialer Auseinandersetzungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen. Nun identifiziert die Weltbank etwa durchaus die Machtlosigkeit der Armen als eine der Ursachen ihrer Situation und fordert ihr „Empowerment“. Aber wer soll sie „ermächtigen“ und wie?
Die Weltbank sollte besser historische Beispiele eines tatsächlichen politischen „Empowerments“ analysieren, meint Alex Wilks vom Londoner Bretton Woods Project, einer Organisation, die Weltbank und Internationalen Währungsfonds kritisch beobachtet. Einige Vorschläge: Movimento Sem Terra (Landlosenbewegung in Brasilien), der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika, die Zapatistas in Chiapas etc.
Zweifellos ist das, was etwa das Movimento Sem Terra gelernt hat, auch „Wissen für Entwicklung“. Das führt zu einer Frage, die bereits am Anfang hätte stehen sollen: Was ist überhaupt „Entwicklung“? Nehmen wir mit dem ökonomischen Querdenker Shann Turnbull an, eine „Verbesserung der Lebensumstände in einem bestimmten Gebiet nach dem Urteil der dort Lebenden“. „Wissen für Entwicklung“ wäre dann, was eine solche Verbesserung fördert. Was eine solche Verbesserung ist, entscheidet die lokale Bevölkerung – daher kann man OHNE sie nicht wissen, was „Wissen für Entwicklung“ ist. Oder sollten wir Entwicklung anders definieren?
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


