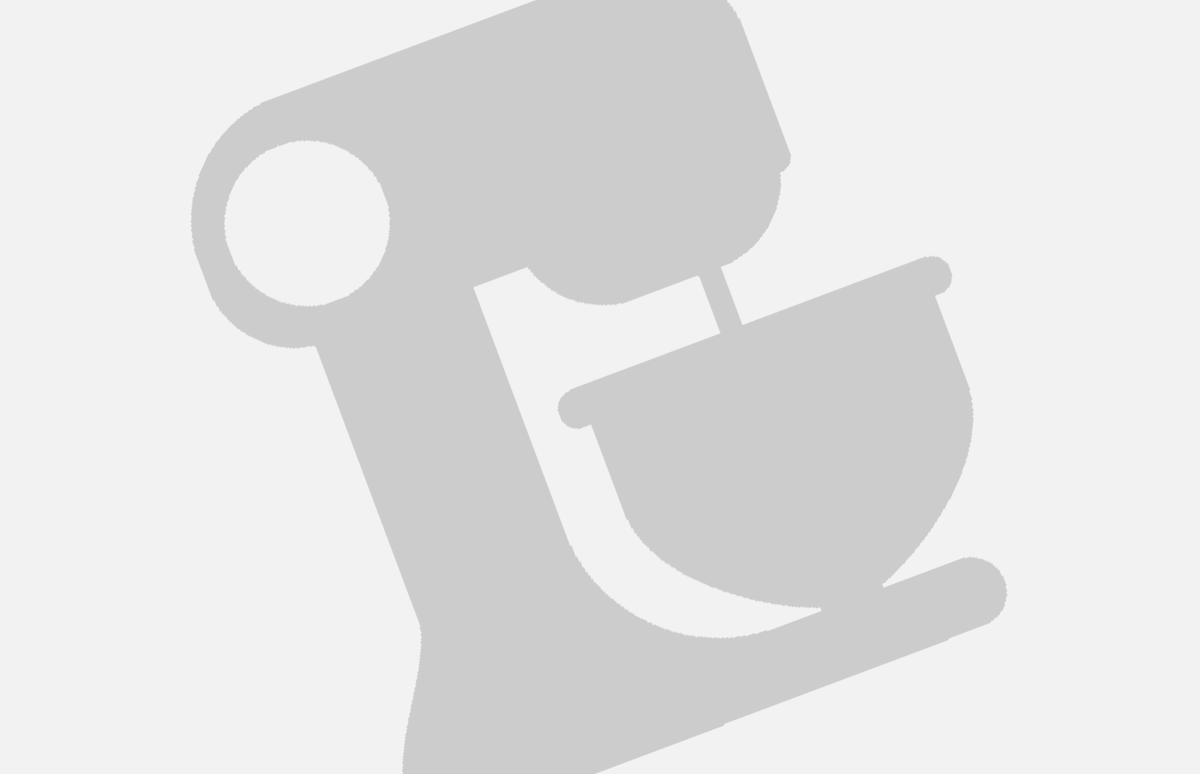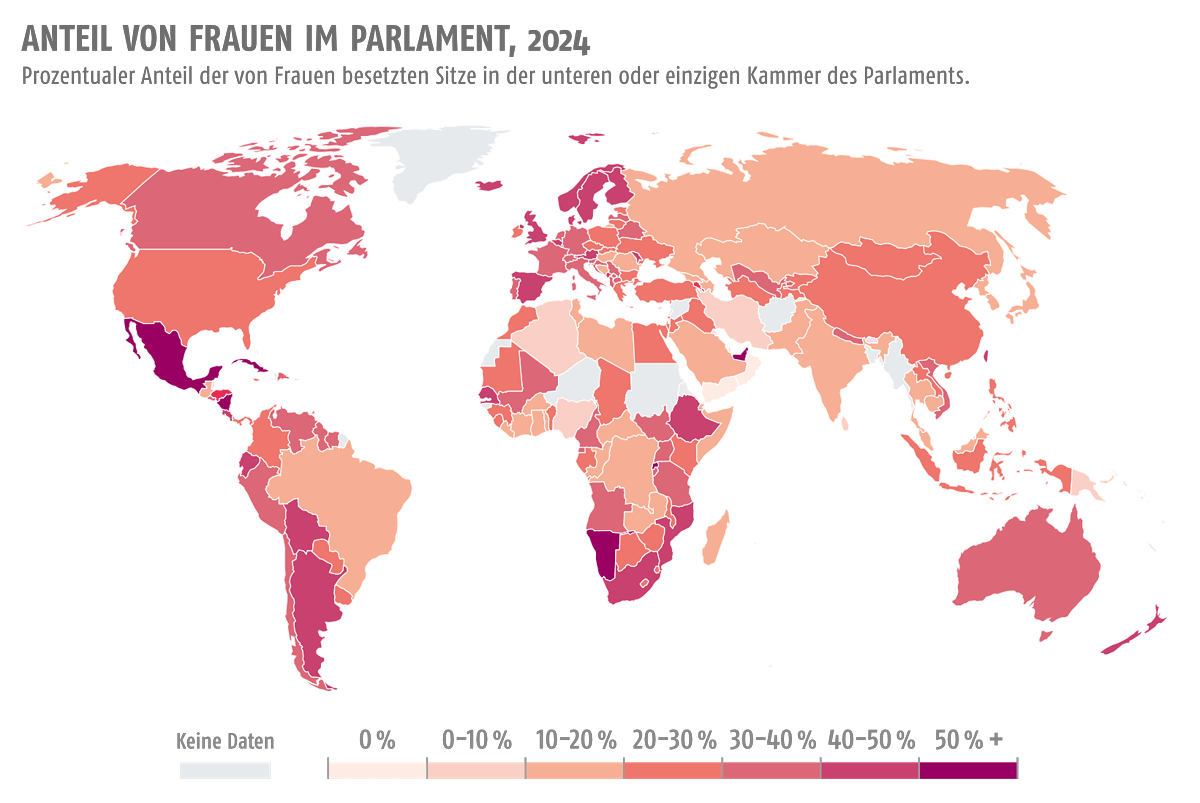
Seit vielen Generationen leben Beduinen in der Negev-Wüste. Der Nationalstaat Israel will sie von ihrem Land vertreiben, doch diese kämpfen hartnäckig um ihre Existenz.
Wir befinden uns an einer Straßenkreuzung in der israelischen Negev-Wüste. Das Beduinendorf Al-Arakib soll hier irgendwo sein. Es ist auf keiner Landkarte und auf keinem Straßenschild zu finden. Haia Noach, eine israelische Aktivistin, die sich für die Rechte der Beduinen einsetzt, fährt mit ihrem Auto voraus. Plötzlich biegt sie nach rechts, in eine kleine Öffnung zwischen zwei Leitschienen. Es staubt und ruckelt. Nach fünf Minuten sind wir da. Was wir sehen, sind die Überreste eines zerstörten Dorfes. Eine Gruppe von demonstrierenden Kindern marschiert vorbei. Sie schreien Slogans ins Megaphon. Heute gehen sie ausnahmsweise nicht in die Schule. Solidarität ist wichtiger. Willkommen in Al-Arakib.
Etwa 180.000 bis 200.000 Beduinen leben in der Negev-Wüste, die mehr als die Hälfte Israels einnimmt. Schon lange vor der Zeit moderner Nationalstaaten haben Beduinen hier gelebt. Nomaden sind sie heute nicht mehr. Und frei auch nicht. Wie die Roma und Sinti in Europa kämpfen sie darum, ihre Kultur und ihre Tradition am Leben zu erhalten. Sie wollen nicht vom Nationalstaat geschluckt werden, wollen auch nicht in die Siedlungen, die man für sie gebaut hat, umziehen.
Haia Noach erzählt, wie Al-Arakib zum neunten Mal innerhalb von sechs Monaten zerstört wurde: „Um acht Uhr hat die Polizei alles abgeriegelt und mit der Zerstörung begonnen.“ Am Abend habe Haia dann gemeinsam mit den Beduinen versucht, einige Zelte wieder aufzubauen. „Damit sie in der Nacht einen Schlafplatz haben.“ Aber die Polizei war sofort wieder vor Ort. „Dann habe ich so viele Leute wie möglich in mein Auto gepackt und versucht abzuhauen. Aber sie haben uns angehalten. Sie haben mit Paintball-Gewehren aufs Auto geschossen und dann alle verhaftet.“ Insgesamt hätten sie neun Leute festgenommen. Die Anschuldigungen: „Nichtbefolgung von Gerichtsbeschlüssen“, „Angriff auf einen Beamten“ und „Steine werfen“.
Wir steigen ins Auto und fahren ein paar hundert Meter eine holprige Straße entlang. Viel ist nicht übrig geblieben vom Dorf. Die Behausungen bestehen aus Holzbalken und Plastikplanen. Nur im alten Friedhof steht ein Container – das einzige „Haus“, das noch steht. Ein Stück weiter unten, am Rand eines ausgetrockneten Flussbetts, flattern drei weitere Zelte im Wind. Hier wohnt auch Hakma Al-Turi, die 17 Mal die Zerstörung ihres eigenen Dorfes miterlebt hat. Ihr Auftreten ist selbstbewusst und sie wirkt stark, obwohl sie keine 1,50 m groß ist.
Haia gibt ihr ein Heft mit Fotos und Gedichten der Kinder von Al-Arakib. Eines von vielen Projekten der Organisation „Dukium“, die sich für friedliche Koexistenz zwischen Beduinen und jüdischen Israelis einsetzt. Eines der Gedichte lautet „Ich leiste Widerstand“. Ein Foto zeigt das zerstörte Zuhause eines der Kinder. Fotografie als ein Weg des Widerstandes. Die meisten anderen Bilder sind positiv und kindlich naiv. Ein Sonnenuntergang, Kinder, die lange Stoffschleifen in den stürmischen Wind halten, Katzen beim Fressen – Motive aus ihrer Welt, wie sie die Kinder wahrnehmen.
Hakma scheint sich sehr über das Heft zu freuen und bedankt sich. Sie hat die letzten 14 Jahre in Al-Arakib gelebt und neun Kinder geboren, wobei das jüngste gerade ein Jahr alt ist. Bevor die Hauszerstörungen im Juli 2010 begonnen haben, hat sie mit ihrem Ehemann und den Kindern in der Landwirtschaft gearbeitet. „Das geht heute nicht mehr. Wir mussten Arbeit finden, die es uns erlaubt, tagsüber im Dorf zu sein, falls sie kommen und wieder alles zerstören“, erklärt sie. Ihr Ehemann und die beiden älteren Söhne, 17 und 23, arbeiten deswegen nachts in einer Hühnerfarm in der Stadt Rahat. Das bringt in etwa 40 Euro pro Kopf und zusammengerechnet immerhin 120 Euro pro Nacht.
Ihr altes Haus war schön und geräumig, erklärt Hakma, während sie nach einem Foto sucht. Sie will uns zeigen, dass sie nicht immer in einer entwürdigenden Baracke gelebt hat. Sie ist eine stolze Frau. Und eine innovative. Damit sie immer alles beisammen hat, wenn die israelische Polizei wieder einmal das Dorf zerstört, hat sie einen kleinen Anhänger gebastelt, in dem sie einen Kühlschrank mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Sachen aufbewahrt. Bis jetzt seien sie damit immer gut davon gekommen, aber diesmal hätte sie die Polizei gestoppt und den Wagen und den Anhänger gleich mitgenommen: „Sie haben uns in unserem eigenen Auto zur Polizeistation gefahren“, ruft Hakma entsetzt. „Der eine fuhr so wild, dass hinten alles aus dem Anhänger rausfiel. Ich habe gehört, wie der andere Polizist zu ihm gesagt hat: ‚Warum nehmen wir diesen Anhänger eigentlich mit? Da ist nur Milch drinnen, keine Waffen‘“, erzählt sie und schüttelt den Kopf.
Al-Arakib ist nur eines der 36 Beduinendörfer in der Negev-Wüste, die von Israel nicht anerkannt werden und als „illegal“ gelten. Lange Zeit bevor der Staat Israel gegründet wurde, pflegten die Beduinen dort einen nomadischen Lebensstil und zogen gemeinsam mit ihrem Vieh zwischen der Sinai-Halbinsel und der Negev-Wüste hin und her. Heute sind sie fast ausschließlich sesshaft. Das war teilweise auch schon während des Israelisch-Arabischen Krieges 1948 so, als die meisten der damals in etwa 65.000-95.000 Beduinen gewaltsam von ihrem Land vertrieben wurden und flüchten mussten. Nur 19 der ursprünglich 96 Beduinenstämme blieben zurück.
Um das Land der Beduinen als Staatsterritorium abzusichern, transferierten die israelischen Behörden 11 der 19 Stämme in eine beschränkte Zone. Das israelische Militär sagte ihnen damals, dass sie aus Sicherheitsgründen nur vorübergehend umgesiedelt würden. Sie durften nie mehr zurück.
In den 1970er Jahren ließ die israelische Regierung dann sieben offizielle Beduinensiedlungen bauen. Was der damalige Landwirtschaftsminister Moshe Dayan 1963 in einem Interview sagte, beschreibt den damaligen Zeitgeist: „Wir werden die Beduinen in ein Stadtproletariat verwandeln. (…) Das ist ein radikaler Schritt und bedeutet, dass der Beduine nicht mehr auf seinem Land mit seinen Herden lebt, sondern ein Stadtmensch wird, der am Nachmittag nach Hause kommt und seine Pantoffeln anzieht.“ Ihnen wurden öffentliche Dienstleistungen versprochen und im Laufe der Jahre zogen viele in der Hoffnung auf ein gutes Leben in die neuen Ortschaften. Heute sind die sieben anerkannten Siedlungen beinahe ebenso vergessen wie die 36 nicht anerkannten Dörfer. Schlechte Infrastruktur, hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind der lebende Beweis für Dayans gescheitertes Projekt.
In etwa die Hälfte der Negev-Beduinen lebt in diesen Ortschaften. Auch Awad Abu-Freikh, der Sprecher von Al-Arakib, hat ein Haus in der Beduinenstadt Rahat. „Ich lebe seit 1995 dort. Ich habe einen Doktortitel in Chemie und brauche einen ordentlichen Arbeitsplatz mit kabellosem Internetzugang. Wenn sie mich hier leben lassen würden, würde ich mein Haus dort verkaufen. Aber ich werde niemals mein Land in Al-Arakib aufgeben, niemals.“ Wie viele andere Negev-Beduinen kann er sein Landeigentum über Generationen zurückverfolgen. Es geht ihnen nicht nur um Besitz, sondern auch um ihre Identität.
Nili Baruch, eine Spezialistin für Landschaftsplanung, erklärt, dass Beduinen untereinander ganz genau wissen, wem welches Land gehört: „Wir haben es hier mit völlig funktionierenden Gemeinschaften zu tun, die Israel einfach nicht anerkennen will.“ Baruch erklärt, dass die Vorgehensweise der israelischen Behörden auch damit zu tun habe, dass sie „die jüdische Bevölkerungsmehrheit erhalten wollen“. Ariel Sharon unterstrich diese Position, als er im Jahr 2000 sagte: „In der Negev haben wir ein ernstes Problem. Es ist ein demographisches Phänomen. Die Beduinen eignen sich neues Land an. Und niemand tut etwas dagegen.“
Doch die Beduinen der Negev-Wüste haben es satt, ein „Problem“ zu sein. Aber wie wird es weitergehen? „Einige Stimmen in der israelischen Regierung sagen: Können wir diese Beduinen nicht einfach evakuieren? Es gibt aber auch Hoffnung. Wir bewegen uns hin zu einer besseren Lösung und erklären der Regierung, dass sie die Bedürfnisse der Beduinen in ihre Pläne einbeziehen müssen“, sagt Baruch.
Awad Abu-Freikh hat seine eigenen Prophezeiungen: „Es wird eine Lösung geben. Entweder sie sperren uns alle ein, oder wir finden einen anderen Weg. Wir sind sehr erzürnt.“ Auch Haia Noach zeigt sich besorgt. Sie erklärt, dass die Beduinen bis zum Äußersten getrieben werden. Das könnte sie bald dazu zwingen, zu extremeren Mitteln zu greifen. Eine dritte Intifada innerhalb von Israel sieht sie jedoch nicht kommen. „Dazu fehlt die Solidarität. Aber wenn all die tausenden Beduinen aus anderen Orten nach Al-Arakib kommen und sich den Behörden entgegenstellen würden, hätten wir eine andere Situation.“
Andreas Hackl hat in Wien Kultur- und Sozialanthropologie und Politikwissenschaft studiert. Er war bis vor kurzem in Jerusalem für die International Crisis Group tätig und arbeitet als freier Journalist.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.