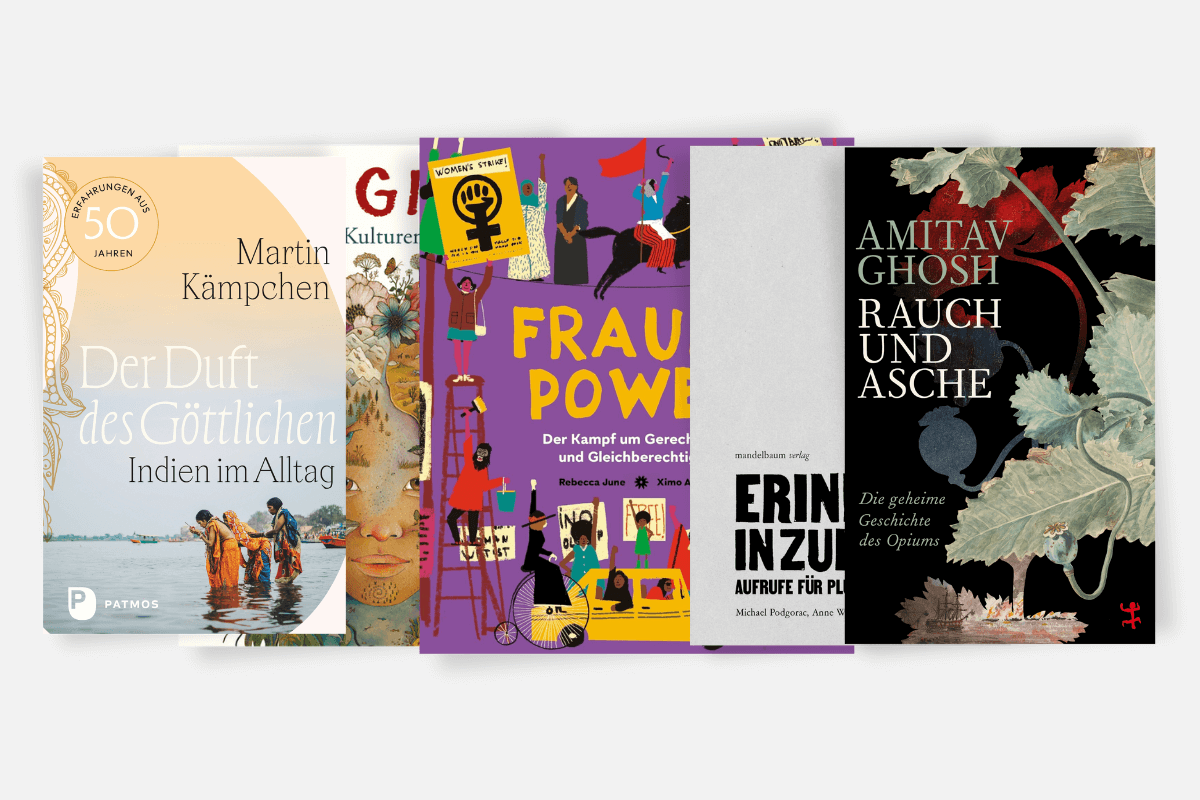
Leises Knistern im Gebälk
Zumindest programmmatisch beginnen die internationalen Finanzinstitutionen, sich von alten Konzepten zu entfernen. Wie weit, steht noch nicht fest.
Dass ihre Forderungen erfüllt werden könnten, hätten sich Mitglieder der INPEG, einer globalen Koalition anti-kapitalistischer Gruppen, ohnehin nicht erwartet: „Wir wollen den IWF und die Weltbank zusperren“, so Alice Dvorska, eine Sprecherin der Koalition. „Jede Form des Dialogs verbessert nur ihr öffentliches Image, und das gehört nicht zu unseren Plänen.“ Nach dem Sündenregister der internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) zu urteilen, keine abwegige Position. Zweifellos wurden die IFIS als Instrument der reichen Länder geschaffen, wie der Harvard-Ökonom Jeffrey Sachs feststellt; und um Ex-US-Außenminister Henry Kissinger zu zitieren, als Mittel zur Durchsetzung der Hegemonie des von den USA vertretenen Systems. Deswegen wurde Lateinamerika zwecks Befriedigung der Gläubigeransprüche ausgequetscht, halb Afrika in ein Testgebiet für Marktreformen verwandelt, politisch missliebigen Regierungen der Geldhahn zugedreht, Diktaturen dagegen bei Bedarf großzügig unter die Arme gegriffen. Und noch immer wird jedes Risiko eines Misserfolgs der IFIs, ob Programm oder Projektkredit, in eklatantem Widerspruch zu Marktprinzipien zu 100 Prozent auf die betroffenen Länder abgewälzt, die sich gegebenenfalls zur Schadensbehebung neu verschulden dürfen.
Doch gerade VertreterInnen von Entwicklungsländern würden ihre Abschaffung als gravierenden Fehler sehen. Weltbankpräsident James Wolfensohn sowie der neue IWF-Chef Horst Köhler „sind für uns zu wichtigen Verbündeten geworden“, betont etwa der südafrikanische Finanzminister Trevor Manuel, Vorsitzender der Tagung in Prag. „Unser wirkliches Problem sind die USA, Großbritannien und Frankreich. Die Demonstranten scheinen das nicht zu begreifen.“
Worauf Manuel Bezug nimmt, sind Auffassungsunterschiede innerhalb der G-7 über Notwendigkeit und Ausmaß einer globalen Regulierung, die insbesondere von europäischen Regierungen angestrebt wird und für Entwickungsländer von Vorteil wäre. Wie weit sind die USA bereit, auf eigene Durchsetzungsmacht zugunsten internationaler Kooperation zu verzichten? Denn als größter Hecht im Teich bräuchten die USA wenig internationale Regeln und fänden auch mit dem Faustrecht – oder dem Marktmechanismus, je nach Bedarf – das Auslangen. Dies ist ein Hauptargument gegen die Abschaffung der IFIs.
Auch einige einflussreichere NGOs können sich mit der Vorstellung eines weiteren Dialogs durchaus anfreunden: „Viele der Bedenken, die die Leute gehabt haben, scheinen ausgeräumt zu sein“, meinte Seth Amgott von der britischen Organisation Oxfam nach einem Zusammentreffen mit den Spitzen der IFIs. Abzuwarten wäre, ob die Weltbank ihre neue Philosophie auch in der Praxis umsetzen würde: „Wir beurteilen sie nach ihren Taten“. „Sie sind Beamte“, meinte Ann Pettifor, Galionsfigur von Jubilee 2000, über Wolfensohn und Köhler. „Wir wissen, wer die wahren Schurken sind. Es sind die G-7.“
Eine Basis der Dialogbereitschaft ist zweifellos, dass zumindest die Weltbank, quantitativ der weltweit bedeutendste „Think tank“ über Entwicklungspolitik, einen gewissen Schwenk im ökonomischen Denken vollzogen hat und dabei ist, zu weniger marktglorifizierenden Konzepten zurückzukehren, wie sie noch vor den 80er-Jahren vorherrschten. Insbesondere die beiden letzten Berichte aus dem Hause Wolfensohn – der Weltentwicklungsbericht 2000 zur Armutsbekämpfung (WDR 2000) sowie die Studie „The Quality of Growth“ – repräsentieren eine signifikante Abweichung von früheren Positionen.
Kurz zusammengefasst betonen beide Berichte, dass zur Bekämpfung der Armut mehr nötig ist als bloss wirtschaftliches Wachstum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf: Arme brauchen mehr Chancen, Sicherheit und Einflussmöglichkeiten, heißt es etwa im WDR 2000, während „The Quality of Growth“ die grundlegende Bedeutung von Faktoren wie Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen, Investitionen in Bildung und Ausbildung, guter Regierungsführung und einem globalen Risikomanagement hervorhebt und deren Effekte auf das Wachstum und die Reduzierung der Armut sogar empirisch belegt.
Bereits diese scheinbar selbstverständlichen Aussagen sind offenbar eine Herausforderung des zuletzt vorherrschenden Paradigmas: „Meinen Sie tatsächlich, dass es einen Fall geben könnte, wo es falsch ist, maximales Wachstum des BIP pro Kopf anzustreben und stattdessen andere Ziele zu verfolgen, etwa Umweltziele?“, so die ungläubige Frage des britischen Economist bei der Präsentation des Berichts „The Quality of Growth“. Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern darauf: „Kurz gesagt ja … nur ein BIP-Wachstum anzustreben ist ein Fehler.“
Illusionen sind allerdings nicht angebracht. Die Weltbank kann sich dem Einfluss ihrer Eigentümer, im wesentlichen die Regierungen der reichen Länder, nicht wirklich entziehen. Eine tiefergehende Infragestellung des Segens der Marktkräfte wird nach wie vor nicht toleriert. Im Juni trat etwa der für die Erstellung des WDR 2000 verantwortliche Ravi Kanbur zurück, offenbar aufgrund politisch motivierter Eingriffe. War im Berichtsentwurf noch zu lesen, „die Kosten der Anpassung an eine Reform des Handelsregimes … werden beinahe ausschließlich von den Armen getragen“, heißt es nun, Marktreformen hätten „nur wenig Einfluss auf die Einkommensverteilung“, und auf die ursprünglich zitierte Studie (Lundberg/Squire) wird bloß in einer Fußnote verwiesen. Lautete zuvor die Botschaft, dass Wachstum auf Basis einer gleicheren Vermögensverteilung die Armut weit rascher beseitigt, heißt es nun: „Niedrige und abnehmende Ungleichheit fördert den Effekt des Wachstums auf die Armut“, wie Rammanohar Reddy von The Hindu, der führenden Tageszeitung Indiens, anmerkt.
Und in Prag wiederholte Chefökonom Stern, angesprochen auf die Sozialverträglichkeit der IFI-Politik während der Asienkrise, das Mantra von der Notwendigkeit, das „Vertrauen der Kapitalmärkte“ wiederherzustellen. Einzige Einschränkung: „Ob wir das Ausmaß der Abwertung, das Zinsniveau genau richtig erwischt haben, darüber müssen wir noch nachdenken.“
Tatsächlich führten die hohen Zinsen jedoch keineswegs zu einer Stabilisierung der Währungen, sondern verschlimmerten die Krise, indem sie die interne Schuldenkrise verschärften und eine Rezession auslösten, wie auch die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) immer wieder betont. Die Stabilisierung ergab sich letzlich durch eine massive Importkürzung und die folgenden Devisenüberschüsse sowie durch Umschuldungen.
Dass die USA die Weltbank während der Asienkrise entgegen der Überzeugung ihres damaligen Chefökonomen, Joseph Stiglitz, gezwungen hatten, die Politik des IWF mitzutragen, war sicher ein Faktor, der mit zum späteren Rücktritt von Stiglitz beitrug. Unter KritikerInnen herrscht jedenfalls weiterhin Skepsis. Vor möglichen Reformen der IFIs im Sinne der Armutsbekämpfung müsste zuerst gründlich analysiert werden, warum die früheren strukturellen Anpassungsprogramme gescheitert sind, fordern etwa Barbara Unmüssig und Miriam Walther von WEED, einem deutschen entwicklungspolitischen Think tank. „Das ist nicht geschehen … noch hat der IWF offiziell zugegeben, dass in der Politik gegenüber Asien und Russland gravierende Fehler gemacht wurden.“
Wohin die Reform geht, ist derzeit nur in Konturen zu erkennen und Beratungsgegenstand verschiedener Kommissionen. Ein Grundelement wäre jedenfalls die Demokratisierung der IFIs, „damit alle Länder und nicht nur die USA etwas zu reden haben“, unterstützt die spanische Tageszeitung El Pais Forderungen, wie sie von NGOs und zuletzt auch von den G-24, einer Gruppe von Entwicklungsländern unterstrichen wurden.
Eines ist jedenfalls sicher: Das „neoliberale Establishment“ scheint beunruhigt – zumindest wenn der Economist dafür als Maßstab gelten kann. „Diese neue Art des Protests“, hieß es in dem historisch dem Freihandel verpflichteten Magazin, „ist mehr als bloß ein Ärgernis: Sie ist erfolgreich“, gefolgt von einer düsteren Prophezeiung: „Falls ihr fortgesetzter Erfolg ihren Appetit (der Nichtregierungsorganisationen; Anm. d. Red.) auf Macht nicht befriedigt, sondern anregt, dann könnte die globale wirtschaftliche Integration gefährdeter sein als viele annehmen.“ Zumindest unter den jetzigen Vorzeichen.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


