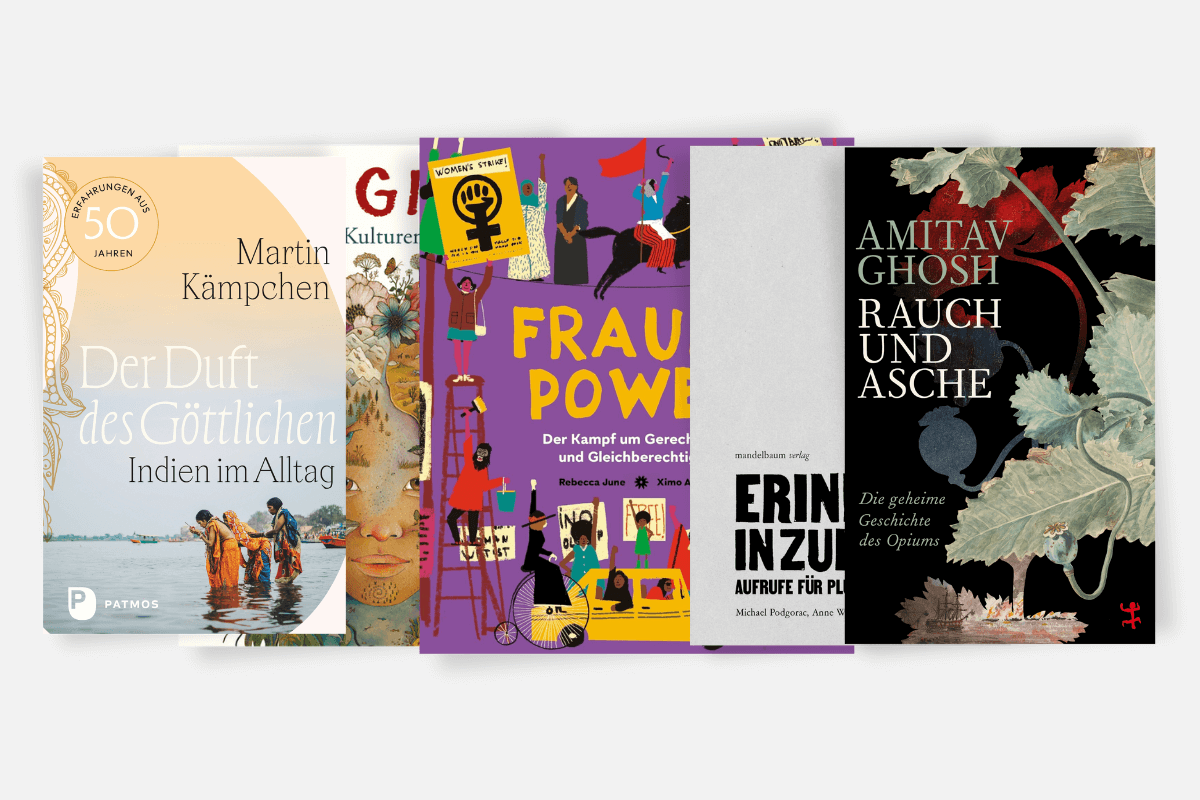
Vier Jahre nach Ende des Regimes von Daniel arap Moi sind Kenias Medien freier und vielfältiger als je zuvor. Doch nach wie vor ist es gefährlich, es sich mit den Mächtigen zu verscherzen.
Diese eher realsatirische Episode aus dem Vorjahr ordnet sich nahtlos ein in die Reihe von bizzaren Skandalen und Affären der Regierung von Präsident Mwai Kibaki. In der Wahrnehmung der Bevölkerung überschatten sie erste Erfolge im Schul- und Gesundheitssektor, die der Regenbogenkoalition seit ihrem Wahlsieg 2002 über Ex-Präsident Daniel arap Moi gelangen. Auch kenianische Medien, in den letzten vier Jahren durch die Vergabe von Lizenzen an private TV- und Radiosender diversifiziert, können heute über Korruption und die Plünderungen von Staatskassen so frei berichten wie nie zuvor. Doch zeigt sich in Aktionen wie diesen auch immer wieder die erschreckende Unberechenbarkeit des kenianischen Staates.
Bestürzt waren die KenianerInnen am 2. März dieses Jahres, als mit Kalaschnikows bewaffnete Vermummte in das Gebäude der Zeitungsgruppe „The Standard“ eindrangen. Auch der Fernsehsender KTN, der zum selben Konzern gehört, war betroffen. In dem einen Haus fackelten die Vermummten tausende Zeitungen ab, in dem anderen stellten sie vorübergehend den Sendebetrieb ein, schleppten Computer und Sendeequipment hinaus. Die Aktion, von Innenminister John Michuki angeordnet, war eine Reaktion auf Berichte über ein Geheimtreffen zwischen Präsident Mwai Kibaki und einem früheren politischen Gegner. Der Zeitung wurde „Veröffentlichung falscher Gerüchte mit der Absicht, die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen“ vorgeworfen. Der britischen BBC gegenüber sagte Michuki, die Razzia sei im Sinne der nationalen Sicherheit angeordnet worden und meinte: „Wenn man eine Schlange schüttelt, muss man damit rechnen, von ihr gebissen zu werden.“ Kurz zuvor waren drei Minister zurückgetreten, nachdem einige kenianische Journalisten Korruptionsskandale enthüllt hatten. Die Informationen darüber waren ihnen offensichtlich aus Regierungskreisen selbst zugespielt worden.
Reporter ohne Grenzen oder die amerikanische Organisation Freedom House kritisieren seit mehr als einer Dekade Jahr für Jahr die unsichere Rechtslage für JournalistInnen in Kenia. Pro forma sei Meinungsfreiheit zwar garantiert. Etliche Gesetze höhlen diesen Grundsatz jedoch aus und führen zu Formen indirekter Informationskontrolle. Dazu gehören unter anderem das Geheimhaltungsgesetz, das Verleumdungs-Gesetz sowie der „Miscellaneous Amendment Act“ von 2002, der Verlage dazu zwingt, vor Aufnahme ihrer Arbeit eine Art Versicherungskaution von rund 13.000 US-Dollar zu hinterlegen. Viele kleinere Publikationen können diese Summe schlichtweg nicht aufbringen. Auch deshalb fällt Kenia im Freedom House-Bericht 2005 in die Pressefreiheits-Kategorie „nicht frei“.
Einerseits sind Kenias JournalistInnen heute noch immer gezwungen, unter schwierigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Sie müssen mit staatlichen Eingriffen rechnen und sind zu oft auf das Wohlwollen der Regierenden angewiesen. Beispielsweise verurteilte man im Jänner 2005 Kamau Ngotho, Reporter des East African Standard, wegen „krimineller Diffamierung“, weil er Verbindungen zwischen Kenias wirtschaftlicher Elite und der Regierung erhellte. Der Justizminister persönlich bewertete das Gesetz, auf dem das Urteil basierte, jedoch als archaisch und überholt, das Urteil wurde fallen gelassen.
Gerade diese Intervention zeigt auch, was sich in Kenia verändert hat: Noch Anfang der 1990er Jahre konnte sich kaum jemand öffentlich erlauben, auch nur einen Witz über den absolutistischen Präsidenten Daniel arap Moi zu machen. Nur wenige kümmerliche von der Regierung zensierte Publikationen lagen aus, voll von Propaganda und Regierungspamphleten. Von Pressefreiheit konnte nicht annähernd die Rede sein.
Heute sind die kenianischen Medien trotz der skizzierten Probleme kritisch und weitgehend frei. Nach Südafrika und Nigeria ist Kenia auch das Land mit der höchsten Internetnutzung in Afrika südlich der Sahara. Der repressive Einparteienstaat und sein staatliches Informationsmonopol gehören der Vergangenheit an, seit Daniel arap Moi abdankte. Selbst der staatlich kontrollierte Fernsehsender Kenya Broadcasting Corporation (KBC) redet zwar nach wie vor der Regierung das Wort, berichtet aber dennoch unabhängiger als unter arap Mois Regime. Sicher, noch immer werden alle KBC-Direktoren von der Regierung berufen. Doch für politische Informationen können viele KenianerInnen heute einfach auf einen der unabhängigeren Privatsender umschalten.
Auch unter den Radiostationen – dem Medium mit der größten Reichweite im Land – finden sich mittlerweile private Betreiber, die teils einfallsreiche journalistische Formate fahren. Zwar durfte 2005 KASS-FM, der Sender der Bevölkerungsgruppe der Kalenjin, eine Woche nicht auf Sendung, weil er angeblich ethnische Ressentiments schürte. KASS-MitarbeiterInnen bestreiten das aber und verweisen auf eine allzu große Regierungsnähe der kenianischen Regulierungskommission für Medien.
Ken Opala, ein bekannter kenianischer Recherchejournalist, bedauert unterdessen, dass sich die politische Polarisierung Kenias auch auf den Journalismus niederschlägt. Es habe den Anschein, als ob die JournalistInnen nicht enden wollende Schlachten zwischen Kibakis „Regierung der Einheit“ und der Opposition ODM-K (Orange Democratic Movement Kenya) austragen. Die beiden führenden Zeitungen „Daily Nation“ und „The Standard“ scheinen sich jeweils auf eine Seite geschlagen zu haben und gelten der jeweils gegnerischen als „parteiisch“. Opala sieht das zwar differenzierter, gesteht aber schwermütig ein, dass einige KollegInnen eigentlich PR-ArbeiterInnen für SpitzenpolitikerInnen seien und gegen Bezahlung positive Artikel über sie schrieben. Zudem befinde sich „The Standard“ zu einem Großteil in den Händen der Familie Daniel arap Mois. „Das macht kritische Berichterstattung nicht einfacher“, bedauert Opala. Solcherlei Bestechlichkeit und Gesinnungsjournalismus haben auch wirtschaftliche Dimensionen. Auch wenn der kenianische Werbemarkt und Verkaufserlöse heute breite Straßenauslagen an Zeitungen und Zeitschriften garantieren, werden die allermeisten JournalistInnen, besonders in der Lokalberichterstattung, miserabel bezahlt und können von wirtschaftlicher Unabhängigkeit nur träumen. Selbst sehr gut dotierte investigative ReporterInnen großer Zeitungen bekommen monatlich kaum mehr als 500 Euro. Nicht sehr viel, um im teuren Nairobi die Familie zu ernähren sowie Wohnung und Auto zu unterhalten.
Gleichwohl ringen kenianische JournalistInnen selbstverständlich um Standards und Berufsethik. Ausbildung spielt dabei eine wichtige Rolle. Und in Kenia findet sich eine der besten auf afrikanischem Boden. Ein Indiz dafür ist, dass neben südafrikanischen auch immer wieder kenianische JournalistInnen internationale Preise verliehen bekommen. Drei staatliche Universitäten bilden JournalistInnen aus und auch Privatschulen offerieren Abschlüsse und Weiterbildungen. Für die großen anerkannten kenianischen Medienhäuser arbeiten mehr und mehr Leute mit solider Ausbildung.
Godfrey Mwampembwa, legendärer Cartoonist für „The Nation“, findet in den Auftritten und Aktionen der politischen Führungsriege jedenfalls genug Futter für seine bissigen Zeichnungen. Für Gado, so sein Künstlername, stellt sich das Politikspektakel der letzten Jahre als Mischung aus „democracy and demoCRAZY (as well as DEMON-crazy)“ dar – aus Demokratie, DemokratIRR und DÄMON-kratie. Und trotz aller Turbulenzen: Niemand käme heute auf die Idee, rotzfreche Cartoons wie die von Gado verbieten zu wollen. Außer vielleicht – in einer schlaflosen Nacht – Lucy Kibaki.
Dennoch lässt sich Reporter Ken Opala seine Skepsis nicht abkaufen: „Klar haben wir heute größere Freiheiten. Aber vielleicht werde ich diesen Satz schon morgen nicht mehr wiederholen. Man kann nicht wissen, was diese Regierung macht.“
Lutz Mükke, Journalist und Wissenschaftler am Institut für Praktische Journalismusforschung in Leipzig, schreibt, filmt, forscht und fotografiert seit zehn Jahren über und in Afrika.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



