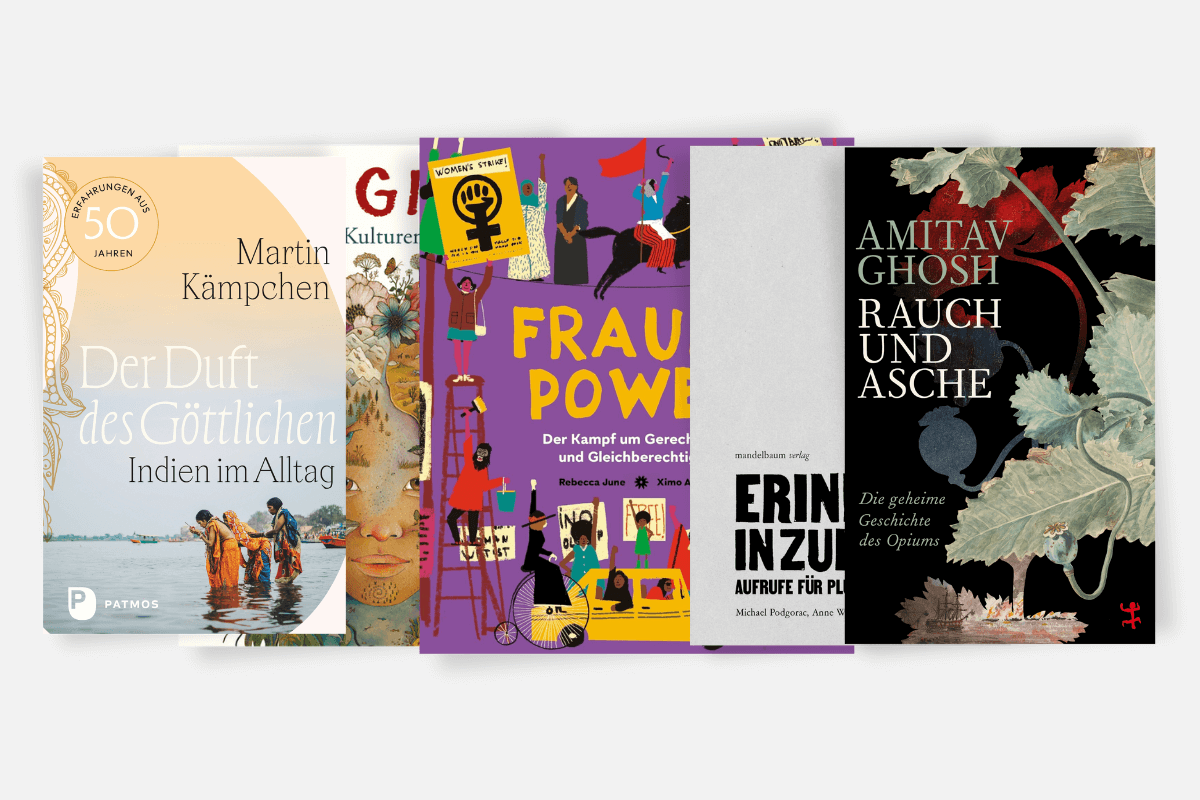
Normen im Spiegel
Die Angst vor Armut hält die (Noch-)Nichtarmen bei der Stange. Unsere Auffassung von Armut zeigt das Wesen unserer Gesellschaft, meint Zygmunt Bauman.
In den von ihr festgelegten Normen, die ihre Mitglieder befolgen sollen, begründet sich jede Gesellschaftsordnung. Sichtbar werden diese Normen aber erst anhand jener, die an ihrer Erfüllung scheitern. Diese werden dann zu einem „Problem“ erklärt, mit dem die übrige Gesellschaft fertigzuwerden hat.
In nahezu allen Teilen der Welt wird die Gesellschaft heute von der Marktwirtschaft bestimmt. Wohlstand und Konsum setzten den Standard. Die Armen geben ihr Geld zuallererst für Brot, Basisgesundheitsdienste, Schulgeld und Miete aus. Und das sind keine profitträchtigen Güter. Ein Dollar in den Taschen der Steuerzahler macht also ökonomisch viel mehr Sinn als der gleiche Dollar in den Taschen der SozialhilfeempfängerInnen. Man geht davon aus, daß ersterer wirtschaftlich sinnvoller reinvestiert wird. Im Wirtschaftsjargon könnte man auch sagen, daß die Armen einfach „schlechte“ Konsumenten sind.
Eine Möglichkeit bestünde nun darin, die Armen aus ihrem Klassenschicksal zu lösen. Genau das ist auch das erklärte Ziel hinter dem amerikanischen „Welfare to workfare“- bzw. dem britischen „Welfare to work“-Programm. Selbst bei erfolgreichem Programmverlauf glauben aber nur wenige der Beteiligten daran, daß die Lebensumstände der Betroffenen dadurch substantiell verbessert oder erträglicher gestaltet werden könnten. Niedrige und unsichere Löhne auf einem unberechenbaren Arbeitsmarkt sind eben ein schwacher Ersatz für regelmäßige und garantierte Sozialhilfezahlungen.
Die Verschiebung läßt allerdings die Armen aus den Sozialstatistiken verschwinden. Sie verlieren ihre moralische Unterstützungswürdigkeit. In den Augen der Öffentlichkeit haben sie somit aufgehört, als „arm“ zu gelten.
In solch einer widersprüchlichen Situation scheint es die beste Strategie zu sein, den Opfern selbst die Schuld zu geben. Da die Armen scheinbar weder zur Produktion noch zum Verbrauch etwas beitragen, sieht man sie nicht länger als Ausgegrenzte, sondern als Verkommene.
Man wirft ihnen vor, einerseits die Werte „anständiger“ Menschen zu verunglimpfen, während sie gleichzeitig die Früchte ebendieser, von ihnen abgelehnten Werte, beanspruchen.
Diese verzerrte Darstellung von Armut in unserer überzogenen Konsumgesellschaft ermöglicht die Abschiebung von Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, aus dem Zuständigkeitsbereich der moralischen Verantwortung in den von Gesetz und Ordnung. Dadurch erscheinen in weiterer Folge die Verwendung von Sozialhilfegeldern für die Subventionierung von Arbeitgebern und sogar der Ausbau der Gefängnisse und des Personalstands bei den Ordnungshütern gerechtfertigt.
Der Anblick der Armut (oder zumindest ihre Darstellung, nachdem die Armen selbst zunehmend aus dem Blickfeld und aus den Städten an die Peripherie, in Ghettos und Wohnheime verbannt werden) hält die Nicht-Armen bei der Stange und im Laufschritt.
Tag für Tag, still und leise untergräbt die Darstellung der Armut dieser Welt die Zuversicht und den Mut all jener, die noch über eine Arbeit und ein geregeltes Einkommen verfügen.
Der Zusammenhang zwischen der Armut der Armen und der Kapitulation der Nicht-Armen hat nichts Irrationales an sich. Der Anblick bitterer Not ist für alle wachen und sensiblen Geister eine warnende Erinnerung daran, daß selbst ein Leben in Wohlstand unsicher bleibt und der Erfolg von heute keinen Schutz vor dem Mißerfolg von morgen darstellt.
Dazu kommt das Gefühl, daß die Erde überbevölkert ist, daß den Regierungen bestenfalls die Wahl bleibt zwischen weitverbreiteter Armut mit hohen Arbeitslosenraten, wie fast überall in Europa und Australien, und weitverbreiteter Armut mit etwas niedrigerer Arbeitslosenrate, wie in den USA.
Die derzeitige Arbeitslosigkeit sieht unheilvoller aus als alle vorangegangenen. Sie scheint jedenfalls keiner zyklischen „wirtschaftlichen Depression“ zu entstammen, keinem temporären Schwächezustand, der mit dem nächsten wirtschaftlichen Aufschwung wieder weggefegt ist.
Auch für jene Jobs, die heute noch zu haben sind, gibt es keine Garantie, ob sie nicht den unvorhersehbaren Entwicklungen der Zukunft zum Opfer fallen werden.
Eine auf Verunsicherung abzielende Wirtschaftspolitik sorgte dafür, daß althergebrachte Schutzmechanismen demontiert und ihre Wächter entmachtet wurden. Die Arbeit wurde „flexibel“, was nichts anderes bedeutet, als daß es für die Arbeitgeber leichter wurde, ihre DienstnehmerInnen nach Gutdünken und ohne Abfertigungen zu feuern und daß Solidarität und wirkungsvolle Gewerkschaftsaktivitäten zum Schutz der zu Unrecht Entlassenen immer mehr zu einem Wunschtraum geraten.
„Flexibilität“ meint in Wirklichkeit die Verweigerung von Sicherheiten. Das Ergebnis ist eine neue Art von Arbeitslosigkeit.
Armut war während dem Großteil dieses und für die Dauer des vorangegangenen Jahrhunderts gleichbedeutend mit dem Fehlen eines Arbeitsplatzes, zumindest in der sogenannten reichen Welt. Arbeit wurde als die Hauptquelle für den Wohlstand einer Nation angesehen. Um ein Stück vom Kuchen zu bekommen, mußte man zuerst bei seiner Herstellung helfen. Arbeitslos zu sein galt daher als abnormal und Arbeitslosigkeit als eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Standard.
Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, mußte versucht werden, „die Leute zurück zur Arbeit zu bringen“, in jenen Zustand also, der für alle als obligatorisch galt.
Andererseits bildeten die Armen so etwas wie eine „Reserve-Armee der Arbeit“. Gesundheitswesen, Schulbildung und ordentliche Wohnbedingungen für die Armen waren somit wirtschaftlich gesehen eine vernünftige Investition. Alle Aufwendungen machten sich bezahlt, sobald zusätzliche Arbeitskräfte auf dem Markt benötigt wurden.
Als nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Siegerstaaten ihre Vorstellungen von einem Wohlfahrtsstaat zu realisieren begannen, gab es eine fast lückenlose Übereinstimmung zwischen den Links- und Rechtsparteien über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines derartigen Systems.
Heute vermehrt man den Wohlstand durch Investitionen in Hochtechnologie, wissenschaftliche Forschung und moderne Informationssysteme.
Aus der Sicht der Gebrauchsgüterindustrie sind die beschäftigungslosen ArbeitnehmerInnen nicht nur vorübergehend außer Dienst, sie sind in Wahrheit strukturell überflüssig. Mit immer weniger Beschäftigten werden immer mehr Waren produziert.
Unter diesen veränderten Voraussetzungen sind Aufwendungen für den Lebensstandard der Armen weder zukunftsträchtig noch eine gute Investition, sie ergeben wirtschaftlich gesehen einfach keinen Sinn. Heute werden keine Produzenten mehr gebraucht, der Markt verlangt vielmehr nach Konsumenten – nach willigen und eifrigen Käufern.
So, wie Karl Marx einst schrieb, als die Geschichte des Kapitals noch zu jung und selbstsicher war, um die Zeichen an der Wand zu erkennen, können sich die ArbeiterInnen auch noch heute nicht befreien, ohne den Rest der Gesellschaft ebenfalls mitzubefreien.
Und in der jetzigen Konsumphase des Kapitals, in der alle Wände längst beiseite geräumt wurden, kann sich die Gesellschaft aus ihrer lähmenden Beunruhigung solange nicht befreien, ehe nicht auch die Armen von ihrem Elend befreit werden.
Der radikale Denker und Schriftsteller Thomas Paine formulierte als erster den Gedanken von einem „Grundeinkommen“, das unabhängig von erbrachter oder verkaufter Leistung ist. Seine Idee war, wie bei solch revolutionärem Gedankengut üblich, ihrer Zeit weit voraus. Erst im darauffolgenden Jahrhundert geriet Arbeit zu einer Art Ware, die man kaufen und verkaufen konnte.
Es sollte ein weiteres Jahrhundert dauern, um die Begrenztheit und Insuffizienz dieses Zustands zu erkennen und die damit verbundene Bedrohung für die ethischen Normen, die gesellschaftliche Solidarität und das Feld der menschlichen Beziehungen sichtbar zu machen.
Der Gedanke, die Grundexistenz von einem Arbeitsverhältnis zu trennen, fand erst zwei Jahrhunderte nach Thomas Paine Beachtung.
Das entscheidende Argument für eine bedingungslose gesellschaftliche Garantie der Grundexistenz ist weder die moralische Verpflichtung gegenüber den Notleidenen, so versöhnend die Erfüllung dieser Pflicht für die ethische Gesundheit einer Gesellschaft auch ist. Noch liegt es in philosophischen Betrachtungen über Gerechtigkeit begründet, so unerläßlich diese für die Bildung und den Erhalt eines humanen Bewußtseins sind. Auch nicht in dem Nutzen einer gemeinsamen Lebensqualität für alle, so entscheidend diese für das generelle Wohlbefinden und den Fortbestand zwischenmenschlicher Beziehungen auch bleibt.
Nein, das entscheidende Argument liegt in der Bedeutung und Notwendigkeit einer wahrhaft autonomen, sich selbst regierenden Gesellschaft, die den Frauen wie den Männern ihren Mut zurückgeben kann, ihre Rolle als BürgerInnen wieder bewußt auszuüben und ihnen die Kühnheit und den Einfallsreichtum verleiht, in dieser Rolle zu brillieren.
Zygmunt Bauman ist emeritierter Professor für Soziologie an der University of Leeds. „Work, consumerism and the new poor“ (Open University Press, 1998) ist der Titel seiner jüngsten Buchveröffentlichung.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


