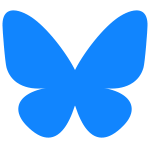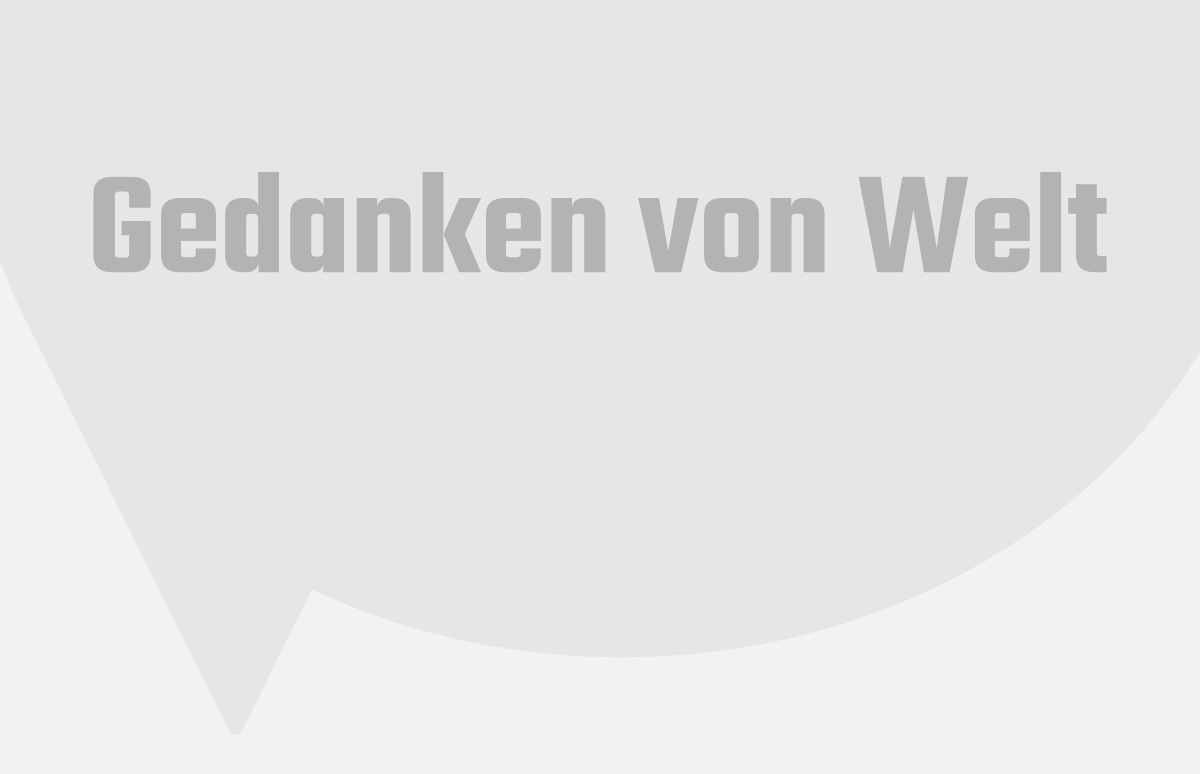
Wie geht es queeren Personen in der Landwirtschaft – in Österreich und in Brasilien? Tatsache ist: so wirklich weiß man das nicht. Es gibt keine Statistiken, kaum politisches Interesse. Warum das so ist und wie die Landwirtschaft ein sicherer Ort wird.
Es war, als ob Luca die ganze Lehrzeit über einen Panzer trug. „Eine Schwuchtel kann nicht arbeiten“ – Sätze wie dieser waren damals am Bauernhof in der Bodenseeregion alltäglich. Nach außen hin gab Luca sich „krass straight“ und fühlte sich dabei fast wie ein:e Verräter:in. „Es ging mir darum, safe zu sein“, sagt Luca. Den Respekt der anderen zu verlieren, sobald sie erfuhren, dass Luca queer ist, das war die größte Angst. Als queer werden sowohl sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, als auch Geschlechtsidentitäten, die nicht binär sind, verstanden.
Queer am Land. Darüber wie es queeren Menschen in der Landwirtschaft in Österreich geht, ist wenig bekannt. „Dass es sie geben muss, war mir klar und es ist auch rein rechnerisch logisch“, sagt Ire Fink, die mit ihrer Masterarbeit „,I stand here, I will not move.‘ Queer farmers‘ lives in Austria“ Grundlagenarbeit geleistet hat.
Den Hauptgrund für die wenigen Daten und Erkenntnisse sieht Fink im mangelnden politischen Interesse. „Wenn Geschlecht oder Sexualität nicht als integrale Faktoren in einem Sektor gesehen werden, fällt das unter den Tisch – ganz so, als gäbe es dort keine Geschlechterrollen und keine Queerness.“
Außerdem seien die katholische Kirche und deren Werte weiterhin in bäuerlichen Institutionen stark verankert. „Das wiederum fördert ein traditionelles Familienbild der heteronormativen Kernfamilie.” Die Struktur der Landwirtschaft baue auf diesem Konstrukt auf. Fink: „Und dann gibt es wichtige und mächtige Organisationen – wie zum Beispiel den Bauernbund, eine Unterorganisation der ÖVP – die diese Positionen bis heute klar vertreten.“
Die Agrarökolog:in hat in ihrer Forschung festgestellt, dass männlich gelesene Personen viel offener Homophobie erleben, als queere Frauen oder weiblich gelesene Queers. „Das ist ein Klassiker. Es wird sehr binär gedacht. Diese Personen haben mit Alltagssexismus zu kämpfen“, erklärt Fink. Sie berichtet von Florian, den sie interviewt hat. Hinter seinem Rücken wird oft getuschelt. Dann heißt es: „Jetzt kommt wieder der schwule Bauer“, wenn er mit dem Traktor in die Werkstatt fährt. Einmal fuhr er zu einem Bekannten, um Holz zu kaufen. Im Ort ist bekannt, dass man dort nach dem Geschäft zu einem Bier eingeladen wird. Florian ist der einzige, dem keines angeboten wird.
Die herrschende Homophobie habe mit der Vorstellung von Männlichkeit zu tun, die für physische Stärke stehe und die Fähigkeit, die Natur zu kontrollieren, erklärt Fink. „Dabei werden 35 Prozent der Betriebe von Frauen geleitet, womit Österreich im Spitzenfeld in der EU liegt. Dennoch werden Höfe weiterhin öfter an Söhne vererbt“, sagt Fink. Frauen und Queers haben in Österreich etwas gemeinsam: Ihr Zugang zu Höfen oder Ackerland ist schwieriger. Übrigens auch zu Ressourcen, etwa Krediten.

Tödliche Gewalt. Um Zugang zu Land – und um Vielfalt, Respekt und Empowerment – geht es auch in der brasilianischen Bewegung der Landlosen. Bereits 2016 bildete das Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), übersetzt die brasilianische Bewegung der Landarbeiter:innen ohne Boden, ein LGBTIQ+ Kollektiv.
„Tatsächlich ist es so, dass alle LGBTIQ+ Personen in Brasilien mit denselben Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert sind, ob am Land oder in der Stadt”, sagt Luana Oliveira, Koordinatorin des Kollektivs. Am Land sind sie nur sichtbarer, weil die Gemeinschaft eine kleinere und übersichtlichere ist. Und das bedeute, dass die Vorurteile auch sichtbarer sind.
Obwohl Homosexualität im südamerikanischen Land seit 1823 nicht mehr juristisch verfolgt wird, liegt Brasilien weltweit an der Spitze, was Gewalt gegen Homosexuelle betrifft. Lindolfo Kosmaski war ein junger schwuler Lehrer, der an der Schule für Agrarökologie der MST studiert hatte. Nach seiner Ausbildung fand er einen Job in der Nähe seiner Eltern in einer kleinen Stadt im Süden. An der Schule, wo er arbeitete, war er beliebt. Doch vor vier Jahren wurde er in der Nähe seines Elternhauses auf brutale Weise ermordet. Der Mörder: Ein Mensch, der seiner Familie nahestand, aber seine Lebensweise nicht akzeptierte. Es dauerte zwei Jahre bis er verurteilt wurde.
Eine andere traurige Geschichte ist die von Fernando dos Santos Araújo. Er war ein schwuler Bauer, ebenfalls aktiv in der MST. 2021 wurde er durch einen Schuss in den Hinterkopf ermordet – ein weiteres Opfer in einer langen Reihe brutaler Übergriffe auf queere Menschen in Brasilien. Bereits 2017 war sein Partner Bruno Pereira Gomes erschossen worden.
Diese Morde stehen exemplarisch für die gewaltsame Realität vieler Aktivist:innen. Der Kampf um Leben und Sicherheit ist für sie untrennbar mit dem Kampf gegen das Kapital verbunden. „Wir sagen immer: Das Kapital ist an Gewalt und Ausbeutung interessiert – wir aber an der Emanzipation der Menschen“, erzählt Oliveira.
Hier bleiben. Deshalb ist der Widerstand vor Ort nicht nur ein Überlebenskampf, sondern auch Ausdruck eines politischen Anspruchs: hier zu bleiben, sich das Land nicht nehmen zu lassen. „Wir erreichen keine Agrarökologie und Ernährungssouveränität, so lange es Gewalt in unseren Territorien gibt“, sagt Oliveira. Agrarökologie ist eine Bewegung, die sich für eine soziale und ökologische Umgestaltung des Ernährungssystems einsetzt – mehr als nur eine Form der Landwirtschaft. „Für eine agrarökologische Lebensweise“, erklärt Oliveira, „müssen wir wissen, wie wir mit Natur und Menschen umgehen sollen und zwar nicht aus einer kapitalistischen und patriarchalen Perspektive, sondern aus einer, die den Menschen, seine Art zu denken und zu leben kollektiv emanzipiert.“
Der erste Schritt zur Veränderung ist, am Land zu bleiben. Das sei nicht einfach, wegen Drohungen und Gewalt. Aber es gibt auch einige, die Widerstand leisten und Erfüllung in ihrer Arbeit finden.
Zurück nach Österreich. Auch Ire Fink hat das beobachtet. „Es ist emanzipatorisch, einfach da zu sein. Dieses: Mich kriegt hier nichts weg, egal was passiert.“ Und seit Kurzem bewegt sich etwas am Land. 2024 hat im oberösterreichischen Bad Ischl erstmals eine Regenbogenparade stattgefunden. Im Zuge dessen entstand das Netzwerk Salzkammerqueer, das eine Anlaufstelle bieten möchte. Seit 2019 gibt es im deutschsprachigen Raum außerdem das Emanzipatorische Landwirtschaftsnetzwerk, ELAN. Die queer-feministische Vernetzung soll Austausch ermöglichen, aber auch Weiterbildung. Paula Gioia von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Deutschland ist dort aktiv. „Wir haben angefangen Kurse und Skill-Sharing-Workshops zu organisieren, z. B. zu Maschinenbau, Reparaturen von Traktoren oder Kettensägen. Das sind meist sehr männlich dominierte Arbeitsbereiche. Es gab so einen Zulauf an Menschen, das hat uns wirklich gezeigt, dass der Bedarf da war.“

Die AbL ist Teil der Bewegung der Kleinbäuer:innen La Vía Campesina, die bereits kurz nach ihrem Entstehen 1993 Geschlechtergerechtigkeit forderte. „Uns war von Anfang an klar: Die bäuerliche Bewegung steht für alle“, sagt Gioia. 2021 veröffentlichte die European Coordination Via Campesina (ECVC) die Broschüre „Embracing Rural Diversity. Genders and sexualities in the peasant movement“, die erstmals Queerness in der Landwirtschaft in Europa, Brasilien und den USA thematisiert. Sie war Ergebnis eines Prozesses, der in der Frauenversammlung begann, wo sie über Queerness sprachen.
Schweigen brechen. „Wenn über Gender gesprochen wird, wird normalerweise über die Unterdrückung gesprochen, die Frauen in der Landwirtschaft erfahren. Aber darüber hinaus wird oft geschwiegen. Egal, ob in Europa oder anderswo“, sagt Gioia, Koordinator:in der ECVC-Broschüre. Der Prozess erfordert Überwindung, Kraft und Mut. „Aber der Moment, in dem du dich outest, kann eine schöne Erfahrung werden – wenn sich andere dann auch trauen“, sagt Gioia.
Seit ungefähr vier Jahren arbeitet Luca nun auf einem Hof in Niederösterreich, der nach soziokratischem Prinzip organisiert ist. Dort ist Luca nicht die einzige queere Person. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine Probleme gibt. „Ein Kollege hat mir erklärt, dass er mich sehr gerne mag und es schade findet, dass ich in der Hölle enden werde“, erzählt Luca. Dennoch gelinge es miteinander zu arbeiten. Und letztlich unterstützt man sich dort, wo die menschliche Erfahrung universell wird. Als Luca eines Tages mit Herzschmerz in die Arbeit kam, gab es von allen Empathie. „Das war lieb – von jeder Person im Team, auch von dem, der mir erklärt hat, dass ich in die Hölle kommen werde. Das hat mich sehr berührt“, sagt Luca.
Andreea Zelinka ist Autorin und Redakteurin bei der Zeitschrift Frauen*solidarität und ist in der Bewegung für Ernährungssouveränität aktiv.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Und das schon mit € 14 monatlich.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.