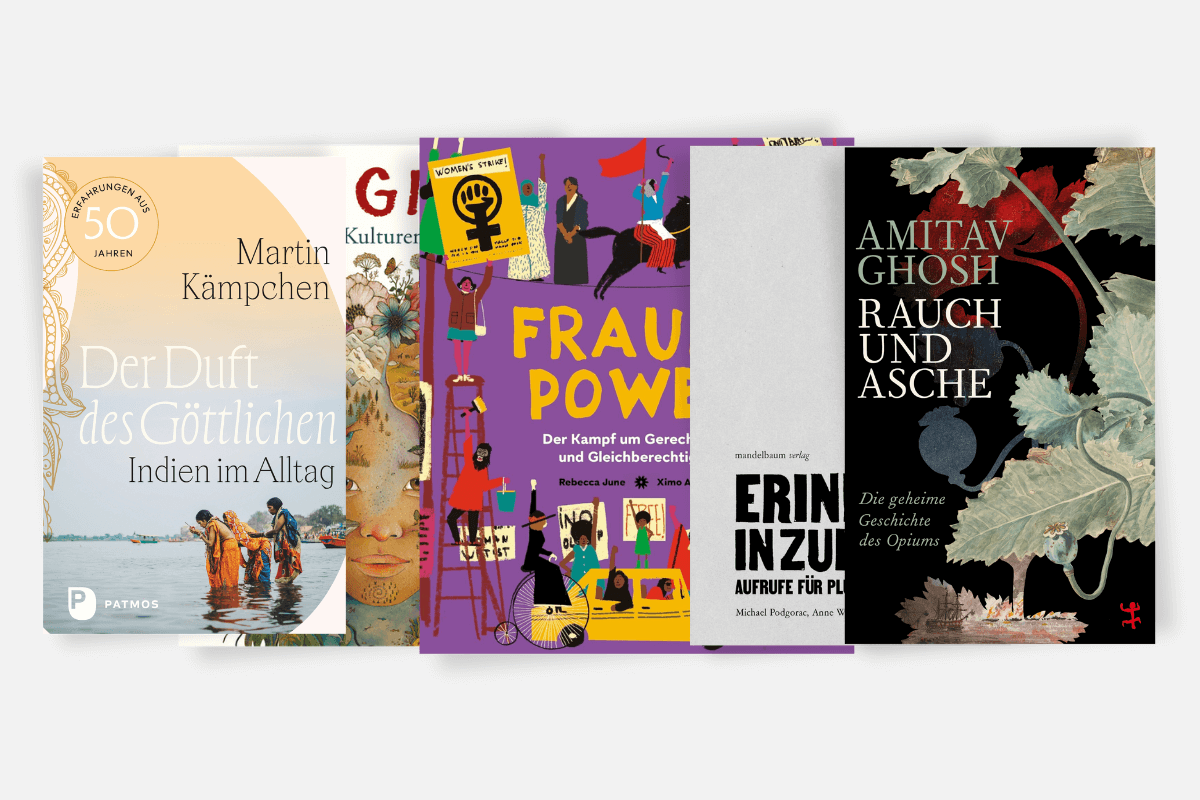
Spaltpilz in Nigeria
Im muslimischen Norden Nigerias führen vier Bundesstaaten die Scharia ein, der Süden wird von der Gewalt ethnischer Jugendverbände erschüttert. Präsident Olusegun Obasanjo fürchtet einen internen Nord-Süd-Konflikt.
Im Norden Nigerias, im Bundesstaat Kaduna, vergisst man für einen Moment die blutigen Unruhen, die hier im Februar tagelang für Entsetzen sorgten. Es gab 400 Tote. Zerstörte Häuser und verbrannte Autos prägten das Bild. Nach einer Demonstration von zehntausenden Christen gegen die Scharia, das islamische Recht, hat das sonst so friedlich wirkende Kaduna, Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, eine ungewohnte Welle der Gewalt erlebt. „Kaduna, der liberale Staat“, hieß es früher. Mit Verachtung schaute man auf den rebellischen Süden und das kriminelle Lagos, doch all dies ist jetzt vorbei. Kaduna steht für eine Art neuen Bürgerkrieg zwischen Christen und Muslimen. Beide Bevölkerungsgruppen halten sich in der Stadt zahlenmäßig ungefähr die Waage. An der Scharia zerbrach der Frieden, hasserfüllt patroullieren jetzt bewaffnete Jugendliche in den muslimischen und christlichen Stadtteilen.
Der Auslöser der Gewalt ist im hohen Norden zu finden, im Bundesstaat Zamfara, an der Grenze zu Niger. Offiziell wurde dort Ende Januar das islamische Recht eingeführt. Auf Delikte wie Diebstahl, Prostitution oder Ehebruch stehen grausame Strafen wie die Amputation einer Hand, die Steinigung, Peitschenhiebe und im Falle von Raubmord sogar die Kreuzigung. Homosexueller Geschlechtsverkehr wird mit 100 Peitschenhieben und einem Jahr Gefängnis bestraft. Ist der Homosexuelle verheiratet, dann droht ihm gar die Steinigung zu Tode. Nur bei lesbischer Liebe ist das Zamfara-Strafrecht gnädiger: 50 Peitschenhiebe und sechs Monate Haft. Zamfara hat es nicht bei der Theorie belassen. Vor wenigen Wochen ist in der Hauptstadt Gusau erstmals ein 18-Jähriger mit 100 Peitschenhieben bestraft worden, weil er Sex mit einer 16-Jjährigen hatte, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Die Auspeitschung erfolgte in der Öffentlichkeit. Auch das Mädchen befand ein islamisches Gericht für schuldig, ihre Auspeitschung soll erst erfolgen, wenn sie von einer Krankheit genesen ist.
„Gott hat mich zum Gouverneur von Zamfara gemacht, damit ich die Scharia einführe“, hat Gouverneur Alhaji Ahmed Sani gesagt. Der 39-jährige Politiker hatte unter dem verstorbenen Militärdiktator General Sani Abacha eine steile Karriere gemacht, war bei der Zentralbank tätig, später Finanzdirektor im Finanzministerium des Staates Sokoto. Da das System Abachas von Korruption durchzogen war, behaupten auch heute noch viele kritische Stimmen, der Zamfara-Gouverneur wolle durch sein Scharia-Experiment nur von seiner düsteren Vergangenheit ablenken.
Zamfara ist erst vor wenigen Jahren neu gegründet worden, als es sich vom Bundesstaat Sokoto abspaltete. Es ist ein strukturschwaches Gebiet mit 2,5 Millionen EinwohnerInnen, die größtenteils von der Landwirtschaft leben. Zamfara ist einer der ärmsten Landstriche in der Bundesrepublik Nigeria, die mit 120 Millionen EinwohnerInnen der bevölkerungsreichste Staat Afrikas ist. Die wenigen Geschäftsleute, die sich bisher nach Zamfara verirrten, scheinen von der Scharia abgeschreckt zu werden. „Für unser Image ist das verheerend“, sagt ein Angestellter des einzigen Luxushotels in der Hauptstadt Gusau. „Zamfara, land of farming“ stand bisher auf den Nummernschildern der Autos. Jetzt wird ergänzt: Zamfara, Land der Bauern und der Scharia. Ein junger Computerhändler sagt, er werde den Staat verlassen und in den Süden Nigerias ziehen: „Hier habe ich nichts mehr verloren.“
Gouverneur Sani hat versprochen, dass die Scharia nur bei Muslimen angewandt wird, nicht bei Christen, doch kaum einer traut der Zusage. Die Polizei muss demnach jeden Straftäter erst nach der Religion fragen, bevor sie ihn entweder vor einen islamischen Richter oder einen Amtsrichter bringt. Durch die schärfere Sittenstrenge fühlen sich die Christen im Lande unter Druck gesetzt. Der Alkoholausschank in Zamfara ist verboten worden, die Bars sind bis auf die Kasinos für die Bundespolizei geschlossen worden. Und es gilt beispielsweise ein Verbot für Frauen, Fahrrad zu fahren oder auf dem Sozius eines Motorrads mitzufahren. Nur noch wenige Frauen trauen sich in Zamfara, dieses billige Verkehrsmittel zu benutzen, sie gehen lieber zu Fuß. Zwar sind einige islamische Frauentaxis eingeführt worden, doch sie reichen nicht aus. Manche Christen reagieren verbittert und entsetzt auf den islamischen Vorstoß. „Ich warte nur auf die erste Amputation, dann wird es hoffentlich eine Klage vor dem Bundesgericht gegen die Scharia geben“, sagt der Dominikaner-Pastor Gilbert Thising aus Gusau.
Zamfara hat eine Kettenreaktion ausgelöst: Im muslimisch geprägten Norden Nigerias haben zwei weitere Bundesstaaten die Einführung der Scharia beschlossen: Niger, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Staat, und Sokoto. Auch in Kano, Yobe und Kaduna war die Einführung der Scharia diskutiert worden, die blutigen Unruhen haben die Debatte jedoch zunächst einmal gestoppt.
Im christlich-animistisch geprägten Süden Nigerias wird das Treiben der Islamisten im Norden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und in der Presse vorwiegend kritisch dargestellt. Die Scharia-Einführung sei das Resultat einer „aufgedrehten Demokratie“, meinte ein Kommentator.
Nach 15 Jahren Militärdiktatur war im Mai 1999 mit Olusegun Obasanjo wieder ein ziviler Präsident an die Macht zurückgekehrt, der sich vor allem den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben hat. Nach den Unruhen in Kaduna hat der Christ Obasanjo zum ersten Mal eine klare Stellungnahme zur Scharia abgegeben, die die Christen schon lange erwartet hatten: Die Scharia verletze die Verfassung, sagte der Präsident, denn bevor ein Gesetz erlassen werde, müsse es erst kodifiziert werden, das sei bei der Scharia nicht der Fall gewesen. In Abuja und Lagos warten viele Scharia-Kritiker darauf, dass der Oberste Bundesgerichtshof Nigerias die Scharia für nichtig erklärt.
Die Scharia ist das jüngste Problem, aber nicht das einzige, das Nigeria in den letzten Monaten destabilisierte. Die Gewalt zwischen ethnischen Gruppen im Süden des Landes nimmt zu. Präsident Obasanjo drohte dem Gouverneur von Lagos an, er werde den Ausnahmezustand über die Metropole verhängen, wenn die Sicherheitslage nicht in den Griff zu bekommen sei. Im letzten Jahr verging kaum ein Monat, in dem nicht aus Lagos oder dem ölreichen Niger-Delta schwere Krawalle mit Todesopfern gemeldet wurden. Es soll seit der Rückkehr zur Demokratie bereits Hunderte von Tote gegeben haben. Auf einem Markt in Lagos lieferten sich im November 1999 Angehörige der Volksgruppen der muslimischen Haussa und der christlichen Yoruba eine blutige Schlacht. Damals starben schätzungsweise 130 Menschen. Viele Häuser wurden niedergebrannt. In den letzten Wochen sorgten brutale Morde an Polizisten für Schlagzeilen.
Die Verbände der ethnischen Volksgruppen geraten zunehmend unter Verdacht, kriminelle Vereinigungen zu sein. So zum Beispiel der Oodua Volkskongress (OPC), benannt nach dem Stammvater der Yoruba, Oodua. Unter dem Militärdiktator Sani Abacha soll der OPC einst eine Untergrundbewegung gewesen sein, die gegen ihn agierte. Doch nach dem Tode des Diktators und Nigerias Rückkehr zur Demokratie änderte sich die Aufgabe des OPC. In wortreichen Appellen versuchen Politiker, die militanten Jugendverbände der Yoruba, Ijaw oder der Arewa zur Mäßigung zu bewegen. Doch es genügt ein Funke, um die Gewalt zu entzünden.
„Die Konflikte in den Städten gibt es seit langem, doch unter dem brutalen Regime von Sani Abacha sind sie unter der Decke gehalten worden. Die Leute fürchteten die Gewalt der Militärs“, sagt Peter Ozo-Eso, der Direktor eines Zentrums für Fortgeschrittene Sozialstudien in Lagos. Nach den Erfahrungen während der Diktatur versuchten die Menschen jetzt in der Demokratie mit allen Mitteln zu verteidigen, was immer sie für ihre eigenen Interessen halten.
Hinzu kommt die Kriminalität. An einem Sonntagmorgen liegt der Leichnam eines jungen Mannes auf der „Third Mainland Road“, der großen Schnellstraße, die auf Brückenpfeilern über die Lagune von Lagos führt. Keiner hält an, Hunderte Autos fahren achtlos vorbei. Ein Mordopfer, ein Unfallopfer? „Vielleicht war das ein Dieb“, sagt der Taxifahrer, „warum sollten die Leute anhalten? Wir halten ja auch nicht an.“
Christoph Link ist Afrika-Korrespondent mehrerer deutschsprachiger Medien mit Sitz in Nairobi, Kenia.
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


