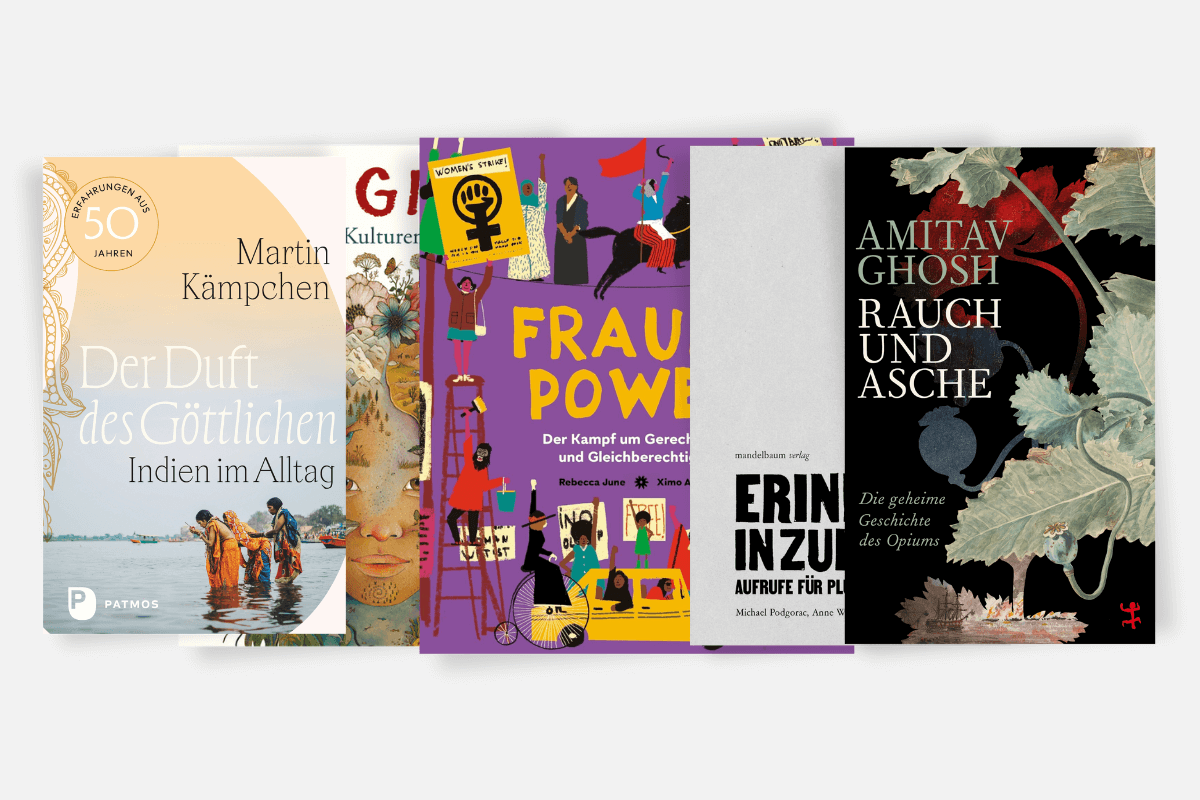
Sprich nicht darüber
Scheinbar ohnmächtig steht Afrika der Ausbreitung von Aids gegenüber. Die Gründe, warum sich die Krankheit so schnell verbreiten konnte, sind mannigfaltig und großteils hausgemacht.
„Ich war erstaunt, als ich es erfuhr“, sagt er heute gefasst. Seine Zukunft, die seiner Frau und der drei Kinder verdunkelte sich mit einem Schlag. James O. ist Gelegenheitsarbeiter und der Einzige, der in der Familie verdient. Wer wird nun für die Medikamente bezahlen, die er brauchen wird? Wer das Schulgeld der drei Kinder? Wer wird für seine Frau sorgen?
Auch seine Frau, die neben ihm am Bett steht, scheint seltsam gefasst. „Ja, wir haben über die Krankheit gesprochen“, sagt sie. „Es ist nicht schlimm.“ Sie meint damit, sie sei ihm nicht böse. Nach einer Beratung wird auch sie einen Test machen, um Gewissheit zu haben. Denn James O. sagt nicht die ganze Wahrheit, wenn er beschreibt, wie er sich infizierte. Hinter dem Satz „Es war ein einfacher menschlicher Fehler“ verbirgt sich, dass er seine Frau vor sieben Jahren verlassen hatte, dann mit
einer Partnerin zusammenlebte, die starb, und dann mit einer anderen, deren Mann schon gestorben war. Nach Nairobi kam er mit der Überzeugung, dass er deswegen ständig krank war, weil seine Arbeitskollegen ihn verhext hatten. Auch das sagt er nicht in dem Gespräch.
Doch nun ist das ganze System zusammengebrochen und zurück bleibt nur die Scham über die tragischen Konsequenzen, die sein Verhalten hatte, und die Ernüchterung. „Ja, natürlich wissen die Menschen Bescheid über Aids“, sagt er. „Aber sie leben nach alten Traditionen, und sie ändern ihr Verhalten eben nicht so schnell.“
Der Fall erscheint tragisch, und dennoch ist er alltägliche Realität in Afrika. Viele Aspekte, die für die rasante Verbreitung der Immunschwächekrankheit Aids auf dem Kontinent verantwortlich sind, spiegeln sich darin wider: Das Krankenhaus, das nicht auf die Idee kommt, einen HIV-Test zu machen, das Verhalten vieler Menschen, die hartnäckig alle Warnzeichen missachten, die Interpretation der Krankheit als Fluch oder Hexerei, die schwache Stellung der Frau in den
afrikanischen Gesellschaften und schließlich die Armut, die eine angemessene medizinische Behandlung unmöglich macht.
Obwohl es auch in Afrika seit Anfang der 90er-Jahre öffentliche Kampagnen gegen die Krankheit gibt, steigt die Zahl der Infektionen weiter sprunghaft an. Im östlichen und südlichen Afrika schwankt die Rate der Infizierten bei den 15- bis 45-jährigen zwischen 10 und 25 Prozent.
12 Millionen AfrikanerInnen sind schon an dem Virus gestorben, allein 2 Millionen im vergangen Jahr.
Neben den menschlichen Tragödien, die sich dadurch abspielen, wird der
Schaden, weil der ökonomisch aktivste Teil der Bevölkerung betroffen ist, für die ohnehin schwach entwickelten afrikanischen Wirtschaften immens sein.
Der kenianische Präsident Daniel Arap Moi zum Beispiel hat vor drei Monaten gesagt, dass nach Schätzungen das Bruttosozialprodukt seines Landes durch den Virus bis zum Jahr 2005 um 14,5 Prozent zurückgehen wird. Der Commonwealth-Gipfel im südafrikanischen Durban rief deshalb Mitte November eine „weltweite Notsituation“ durch Aids aus.
Die Gründe, warum sich Aids so rasant auf dem Kontinent verbreiten konnte, sind mannigfaltig und zum großen Teil hausgemacht. Einen Teil der Verantwortung müssen sicherlich die politisch Verantwortlichen selbst übernehmen. Präsident Moi zum Beispiel, der heute die Folgen besonders drastisch zeichnet, vermied bis zum November 1998 noch, das Wort „Aids“ öffentlich in den Mund zu nehmen.
Getreu der afrikanischen Tradition, dass zwischen dem Wort und dem Ereignis eine magische Verbindung bestehe und dessen Erwähnung allein es schon heraufbeschwören könne, sprach er zuvor immer nur von „diesem Ding“.
„Die Politiker, Pfarrer und traditionellen Chiefs fangen nun an, über Aids öffentlich zu sprechen“, sagt Esther Gatua vom Kenianischen Aids Konsortium, einem Zusammenschluss von Nicht-Regierungsorganisation, „Aber sie haben damit einfach zu lange gewartet.“
In den autoritären afrikanischen Gesellschaften, in denen Neuerungen immer nur von oben angestoßen werden, ist das Verhalten der Oberen von zentraler Bedeutung.
Besonders deutlich wird das am Beispiel Ugandas, wo Präsident Yoweri Museveni Aids schon 1991 „das schlimmste Gesundheitsproblem, das die Region je erlebt hat, von den Pocken vor 1900 abgesehen“ genannt und eine aktive Präventionspolitik eingeleitet hat. Jetzt sind erstmals in diesem Land die HIV-Infektionsraten zurückgegangen.
Aber auch die afrikanischen Traditionen im Umgang mit Sexualität tragen
einen großen Teil zur Verbreitung der Krankheit bei. Nach einer Untersuchung des staatlichen Kenianischen Aids-Kontrollprogrammes sind über 90 Prozent der Bevölkerung über die Übertragungswege und die Folgen von Aids informiert, aber ihr Verhalten ändern die Menschen trotzdem nur selten.
In den ländlichen Regionen werden die Jugendlichen traditionell bei der Initiationszeremonie aufgeklärt, und in vielen Gesellschaften ist es ein Tabu, dass die Eltern mit ihren Kindern über ein derartiges Thema reden. Männer reden in den seltensten Fällen offen darüber mit ihren Frauen, und wenn jemand im Krankenhaus in Nairobi an den Folgen von Aids stirbt, versuchen die Verwandten oft die Ursache geheim zu halten, weil die Krankheit mit einem solchen Stigma belegt ist.
In einigen Regionen Afrikas ist es üblich, dass Witwen von einem Verwandten des Verstorbenen „geerbt“ werden. In Nyanza, der am stärksten betroffenen Provinz, im Südwesten Kenias, zum Beispiel müssen sich Witwen einem Reinigungsritual mit einem Mann unterziehen, das Geschlechtsverkehr einschließt, weil sie sonst von gesellschaftlichen Kontakten ausgeschlossen wären. Was ursprünglich dazu diente, die Versorgung von Witwen zu sichern, ist in den Zeiten der wirtschaftlichen Not zu
einem Geschäft geworden. Die Witwenerben haben einen Beruf daraus gemacht, nisten sich oft bei den Frauen ein und lassen sich für das Ritual bezahlen. Viele sind sie HIV-positiv, und durch die Praxis wird die Krankheit weit verbreitet.
Im Westen Kenias wird Aids auch oft als „Chira“ – in der lokalen Sprache
„Fluch“ – bezeichnet und fehlinterpretiert. Nicht eine Krankheit ist demnach daran
Schuld, dass die Menschen dünn werden und sterben, sondern dass sie sich nicht an die Traditionen ihrer Ahnen gehalten haben und dafür bestraft werden.
Jetzt, da schon so viele Menschen infiziert sind, rückt die Diskussion um erschwingliche Medikamente für Afrika in den Vordergrund. „Wir verwenden außer Antibiotika gegen Infektionen vor allem Kräuter, um das Immunsystem der Kranken zu stärken“, berichtet Anne Owiti vom Selbsthilfeprojekt in Kibera. Zwar wurde im August in Uganda ein Medikament getestet, das die Übertragung des Virus auf die Kinder durch die Muttermilch um fast die Hälfte verringert, aber ob dieses Nevirapin
tatsächlich kostengünstig in Afrika erhältlich sein wird, ist noch unsicher. Südafrika und Uganda haben ein Abkommen geschlossen, um die Pharmakonzerne zu drängen, das Medikament billig zur Verfügung zu stellen.
Auch im Fall von AZT, mit dem in den Industrieländern inzwischen gute Erfolge bei der Aids-Therapie erzielt wurden, wollten die afrikanischen Staatschefs Druck ausüben, um das Medikaments zu seinen Herstellungskosten zu erhalten. Dann würde die Behandlung einen US-Dollar pro Tag kosten. Doch die Patenthalter in Frankreich und den USA argumentieren, dass sie auch die Entwicklungskosten des Medikamentes auf den Verkaufspreis umlegen müssen. Dabei kommt das Geld für die Forschung ohnehin größtenteils aus öffentlichen Mitteln.
Hilfreich war es da sicher nicht, dass der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki Ende Oktober in einer Parlementsrede sagte, dass es „unverantworlich“ sei, AZT zu verwenden, denn die Wirkung des Medikaments sei nicht bewiesen.
Diese Diskussion dürfte für James O. nicht mehr von Belang sein. Er wird
mit einem unguten Gefühl nach Nyanza zurückgehen. „Wenn man im Busch ist, ist es schwer, in ein Krankenhaus zu kommen. Und dann habe ich ja nicht einmal das Geld, um Medizin zu kaufen“, sagt er. Seine Frau hofft, dass ihr ältester Sohn sie unterstützen kann, wenn er in ein paar Jahren mit der Schule fertig ist.
Der Autor ist Afrika-Korrespondent der Berliner Tageszeitung
Globale Perspektiven – jederzeit, überall
6 Ausgaben pro Jahr als E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Globales im Blick mit unserem Kombi-Abo
6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und E-Paper
12-seitiger Themenschwerpunkt pro Ausgabe
12 x Extrablatt per E-Mail (redaktioneller Newsletter mit 3 Extra-Artikeln)
voller Online-Zugang inklusive Archiv
Qualitäts-
journalismus schützen
Mit einem Soli-Abo leisten Sie einen ganz besonderen Beitrag für das Südwind-Magazin.
Sie können zwischen dem Digital- oder Kombi-Abo wählen und erhalten zusätzliche Extras wie exklusive Berichte aus der Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


