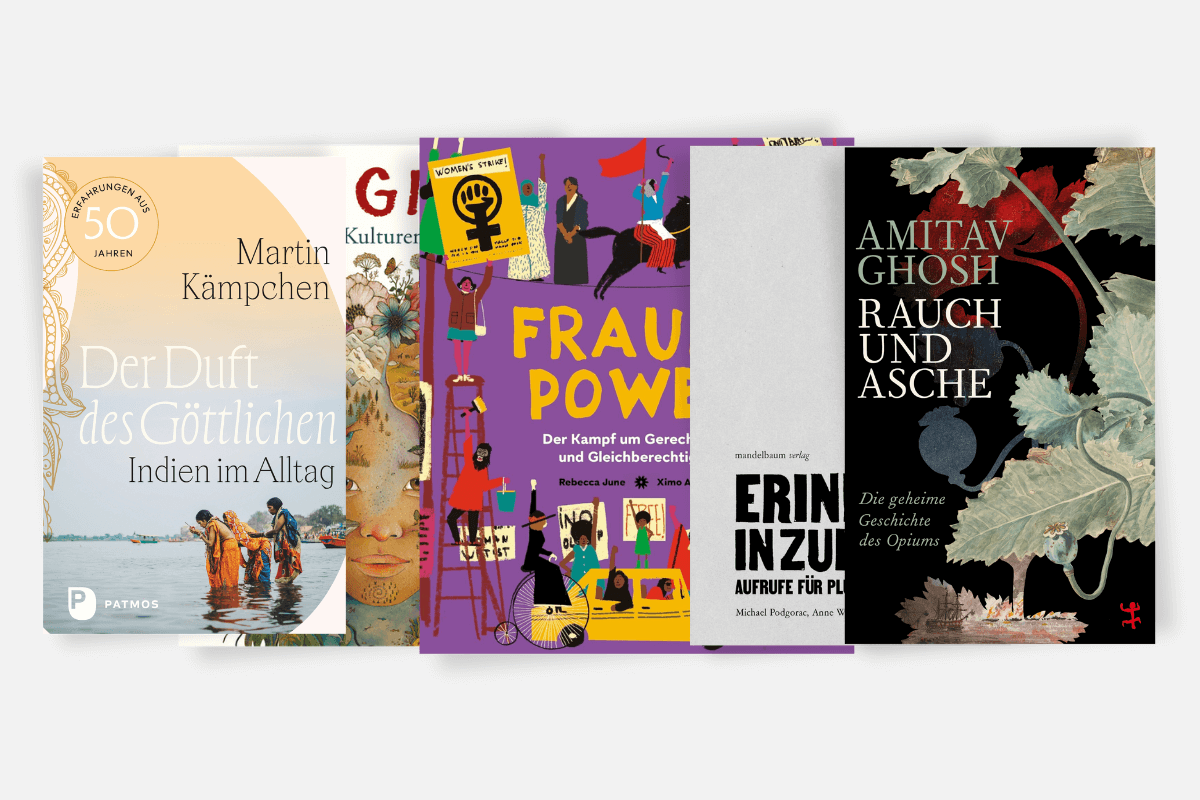
Warten auf Entscheidung
In algerischen Flüchtlingslagern hoffen Saharauis seit 25 Jahren auf die Unabhängigkeit ihres Staates Westsahara. Einige träumen von der Rückkehr, die jüngere Generation allerdings fühlt sich eher in den Lagern zu Hause und kann den Traum vom eigenen Staat nicht teilen. Fotos von Bärbel Högner
Fatma Babi träumt vom Meer. Sie erinnert sich an unbeschwerte Tage an den Stränden des Atlantik, in der Westsahara. Ihre Jugend endete früh. Sie war gerade 15 und trug schon ein Kind unter dem Herzen, als sie bei Demonstrationen in der Hauptstadt La Ayoun die Parolen der Frente Polisario mitbrüllte: „Franco, stirb endlich!“ „Spanien raus!“. Spanien zog sich aus der afrikanischen Kolonie zurück, schneller als die Saharauis reagieren konnten. Am 31. Oktober 1975, kaum war der letzte spanische Soldat abgezogen, rückte Marokko als Besatzungsmacht nach.
Fatma flüchtete mit ihrer neugeborenen Tochter auf dem Arm, wie alle Nachbarn, die aus den über Nacht mit Stacheldraht umzäunten Saharaui-Vierteln entkommen konnten. 20 Tage später und rund 300 km südöstlich, in Oum Draiga, wähnten sie sich sicher. Nach drei Monaten kamen marokkanische Flieger und warfen Napalm und Phosphorbomben. Wieder flüchteten die Saharauis, diesmal bis hinter die algerische Grenze in die Nähe von Tindouf, rund 1.000 km entfernt.
Fatma, heute 45 Jahre alt, hat ihre Eltern, die unter marokkanischer Besetzung zurückblieben, nie wieder gesehen. Hin und wieder klappt es mit einem Telefonanruf.
Die jüngere Tochter Nicha hört den Geschichten ihrer Mutter geduldig zu, aber die Sehnsucht nach dem Meer teilt sie nicht. Für die 22-jährige Krankenschwester ist es selbstverständlich, Lebensmittel von internationalen Hilfsorganisationen zu bekommen, Essen auf dem Gaskocher zu bereiten, im Zelt zu wohnen. Was Fatma mühsam mit aufgebaut hat, gehört für Nicha zum Alltag: Die Schulen, die Müllabfuhr, der Omnibus, der regelmäßig zwischen den Lagern zirkuliert und die kostenlose Gesundheitsversorgung in den kommunalen Krankenhäusern, nicht zuletzt ein nationales Parlament und Ministerien, eine komplette Staatsstruktur. Nichas größter Wunsch ist ein Reisepass: Dann könnte sie ihre ältere Schwester in Mauretanien besuchen oder ein Praktikum in einem spanischen Krankenhaus machen.
Seit einem Vierteljahrhundert werden die 165.000 Saharauis vom internationalen Hilfsbusiness versorgt. 25 Jahre Linsen, Reis und Bohnen, 25 Jahre Fisch aus der Dose. Hin und wieder werden Eier verteilt aus der Legebatterie, die Frankreich den Saharauis schenkte.
„Wir sind ein kleines Volk, aber wir haben einen starken Willen“, sagt Souiliki Sidi Mohamed. Er nestelt aus den Tiefen seines Kaftans einen Ausweis hervor, ausgestellt von den spanischen Kolonialbehörden. „Beruf: Scheich“ steht auf dem Plastikkärtchen. Souiliki ist Sprecher der 3.000 Menschen vom Stamm „Reguibat es-Sahel Souaad Ahel Bra Brahim“. Er hat der UNO geholfen, die Wahlberechtigten für das Referendum zu identifizieren, die laut UNO-Friedensplan von 1991 über die Unabhängigkeit der Westsahara abstimmen sollen. Acht Jahre lang zögerte Marokko das Referendum hinaus. UNO-Chef Kofi Annan will jetzt eine Lösung für die verfahrene Lage. In seinem Namen verhandelt der Generalbevollmächtigte James Baker, ehemaliger US-Außenminister, mit allen Beteiligten über einen Ausweg, bei dem niemand das Gesicht verliert. Der 77-jährige Scheich spricht aus, was hier viele denken: „Wenn wir die Unabhängigkeit nicht bekommen, werden wir kämpfen.“ Für Souiliki ist die Sache einfach: „Jeder nimmt sein Gewehr, der Sieg ist unser.“ Souiliki vergleicht seine Erfahrungen: „In der Kolonie lebten wir unter den Anweisungen der Spanier, jetzt regeln wir unsere Angelegenheiten selbst.“ Nur das eigene Territorium fehlt noch.
Selbst Abdelwadud Mohamed, der im Unabhängigkeitskampf ein Auge verloren hat, dem die Ärzte über drei Jahre in mehreren Operationen Splitter aus dem linken Arm und dem linken Bein entfernten, nachdem er 1987 über eine Mine fuhr, pflichtet dem Scheich bei. Der Verwalter des Gemeindehauses von Smara erwartet, nach der Unabhängigkeit der Westsahara eine staatliche Rente zu bekommen. „Schließlich habe ich die besten Jahre meines Lebens in der Wüste verbracht“.
Die Unabhängigkeit, sagt der 38-Jährige, ist wichtig, denn ein Volk kann nur von seinen Reichtümern leben, wenn es souverän ist. Viele seiner Sätze beginnen mit den Worten „Nach der Unabhängigkeit…“ Dann werde er reisen und schöne Frauen kennen lernen.
Unterstützung bekommen die Saharauis vor allem von Dritte-Welt-Staaten. Ihrem National-Krankenhaus gegenüber steht das „Haus der Kubaner“. Im Flur hängen die Poster vom saharauischen Präsidenten Mohamed Abdelaziz und Fidel Castro einträchtig nebeneinander. Ein Bambusgerüst deutet eine Strandbar an. Jorge Salgado und seine Kollegen von der kubanischen Ärztebrigade arbeiten hier elf Monate im Dienste der internationalen Solidarität. Elf Monate, von denen die Kubaner jeden einzelnen Tag an einem Wandkalender abstreichen. Sie haben sich freiwillig gemeldet, aber das Klima und die Trennung von der Familie machen ihnen zu schaffen. Dass der Einsatz in Dollars vergütet wird, tröstet nur wenig.
Jedes Jahr schickt die Frente Polisario ihre besten Schüler nach Kuba, in diesem Jahr 600 Kinder im Alter von etwa 14 Jahren. Sie absolvieren dort das Gymnasium und ein Studium. Am Tag nach der Abschlussprüfung endet ihre Aufenthaltsgenehmigung, sie kehren in die Flüchtlingslager zurück.
Eine von ihnen ist Lilli. Fast täglich schaut sie bei den kubanischen Ärzten vorbei. Lilli trägt enge schwarze Jeans, hochhackige Stiefel und knallroten Nagellack. Den traditionellen Umhang der saharauischen Frauen hat sie so kurz gebunden wie möglich. Der Kubaner Jorge frotzelt sie: „Na, wie geht’s dir in deinem Flüchtlingslager?“ Lilli: „Wir sind keine Flüchtlinge! Meine Heimat ist hier, in der Wüste. Hier lebt meine Familie, also ist das meine Heimat.“ Jorge schüttelt den Kopf. Er schaut aus dem Fenster auf die endlosen Sandmassen der Sahara und träumt von der karibischen See. Anders als die Saharauis weiß Jorge, wann er die Chamada verlassen wird: In sechs Monaten und elf Tagen.
Charlotte Schmitz ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten Türkei, Naher Osten und Nordafrika. Sie lebt in Frankfurt.





