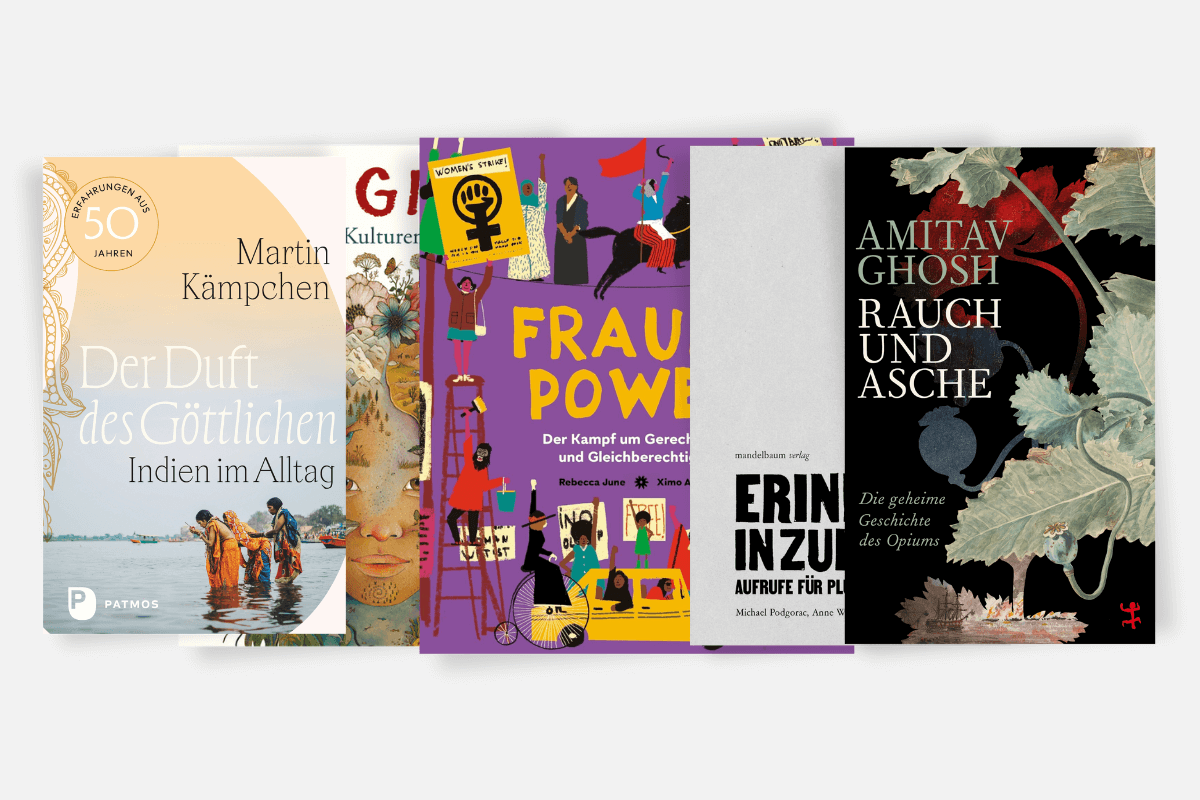
In Kirgistan, einst als „Schweiz Zentralasiens“ gepriesen, herrschte im vergangenen Juni Krieg: Feuer, Folter, Mord, Flucht. Jahrzehntelang hatten ethnische Kirgisen, Usbeken, Russen und Tadschiken in friedlicher Koexistenz zusammengelebt.
Vierzehn bewaffnete Männer stürmten in meinen Garten und fragten nach meinem Sohn – warum, weiß ich nicht“, erzählt die sechzigjährige ethnische Usbekin mit Tränen in den Augen einer Mitarbeiterin von Human Rights Watch. „Einige von ihnen wollten mich töten, aber der Älteste, so um die 30, stoppte sie. Ich sagte, niemand sei zuhause, aber sie glaubten mir nicht. Sie rannten in das Gebäude, wo mein Sohn war. Als sie wieder raus kamen, legten sie Feuer, während mein Sohn noch drinnen war. Ich habe geheult und geschrien. Draußen sah ich, wie sie meinem 56 Jahre alten Nachbarn die Kehle durchschnitten, sein Haus ebenfalls anzündeten und seine Leiche hineinwarfen. Der tote Körper eines 14-Jährigen von nebenan lag auf der Straße.“
Hunderte wurden getötet, Tausende verletzt, vergewaltigt, ausgeraubt. In Osch, der zweitgrößten Stadt Kirgistans, standen ganze Stadtteile in Flammen. Warum, ist bis heute nicht geklärt. Spekuliert wird, dass Schergen des im April 2010 gestürzten Präsidenten Kurmanbek Bakijew zum Massenmord angestiftet haben, um die Wahl der parlamentarischen Verfassung und somit die Abschaffung des Präsidialsystems zu verhindern – was aber trotz der Pogrome nicht gelang. Andere behaupten, die ethnischen UsbekInnen hätten eine Abspaltung des Südens forciert. Und wieder andere vermuten, dass Bebauungs- und Investitionspläne für die abgebrannten Stadtteile von Bürgermeister Melis Myrzakmatow, der auch unter Bakijew schon im Amt war, durchgesetzt werden sollten.
Das Ergebnis der Kämpfe ist auf jeden Fall verheerend: 200.000 meist ethnische Usbeken flüchteten Richtung Usbekistan, weitere Tausende nach Norden – insgesamt leben nur fünf Millionen Menschen in Kirgistan. Usbekistan schloss die Grenzen. Hilfsorganisationen bauten Zeltstädte in der kargen Landschaft. Wer über die finanziellen Mittel verfügte, flüchtete Richtung Russland. Die anderen, die ohne Alternative, kehrten zurück.
Zwischen den Ruinen ihrer Häuser – die Blumentapete ist unter dem Ruß noch sichtbar, Dach, Türen und Fenster fehlen – bauten die ethnischen UsbekInnen provisorische Unterkünfte. Noch heute haben sie Angst vor weiteren Übergriffen, Racheakten. Bei plötzlichen Verhaftungen muss die Familie schleunigst viel Geld organisieren, um die Verwandten freizukaufen. Die Korruption ist groß. Und jeder Tag in Polizeigewahrsam erhöht das Risiko von Folter und Tod. Das Vertrauen der ethnischen UsbekInnen in Militär und Polizei ist schwer erschüttert.
Nach Informationen der internationalen Organisation Human Rights Watch (HRW) wollten die Sicherheitsorgane die Pogrome nicht unterbinden, waren teilweise sogar aktiv beteiligt. „Die gewaltsamen Unruhen im Juni haben tiefe Narben hinterlassen“, sagt Ole Solvang, HRW-Experte für Krisenregionen. „Es muss Gerechtigkeit für das begangene Unrecht geschaffen und alle Volksgruppen müssen in gleicher Weise geschützt werden.“
Die von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in die Städte Osch und Dschalalabad entsendeten internationalen Polizisten lehnte die damalige Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa im August noch ab. Sie könne ihre Sicherheit nicht gewährleisten. Provoziert hatte diese Situation Myrzakmatow, Bürgermeister von Osch: „Das Stadtparlament hat klar ‚nein‘ gesagt. Wir erlauben nicht, das Kosovo-Experiment im Ferghana-Tal zu wiederholen.“ Der Machtbereich der Zentralregierung erstrecke sich nicht auf Osch, verhöhnte er Otunbajewas Übergangsregierung.
In keinem anderen Land des von autokratischen Despoten beherrschten Zentralasien wechseln die Machthaber derart häufig wie in Kirgistan. Bei der Parlamentswahl im Oktober wurde die Verfassungsänderung zur Stärkung des Parlaments und zu ungunsten der Machtfülle des Präsidenten bestätigt. Die Parteienlandschaft zeigt sich zersplittert. Die sozialdemokratische Partei, der Übergangspräsidentin Otunbajewa nahe steht, landete auf Platz zwei. Zur stärksten Partei wählten besonders die Kirgisen im Süden die nationalistische Ata-Schurt, in der sich die AnhängerInnen des gestürzten Ex-Präsidenten Kurmanbek Bakijew versammeln. Sie stellen 28 Abgeordnete der Dschogorku Kenesch, des Parlaments mit 120 Sitzen. Ebenfalls den Einzug schafften die pro-russische Partei Ar-Namis, die Partei Respublika und die Mitte-Links-Partei Ata-Meken.
Im Jänner einigten sich, nach schwierigen Koalitionsverhandlungen, Sozialdemokraten, Respublika und Ata-Schurt auf eine neue Regierung. Gemeinsam versuchen sie jetzt einen Neuanfang als erste parlamentarische Demokratie Zentralasiens. Diese Regierung vereint AnhängerInnen des Ex-Präsidenten Bakijew – über die Hälfte der Abgeordneten waren auch schon unter ihm im Amt – und dessen GegnerInnen. Als die führenden Köpfe beim Sturz von Bakijew gelten die Präsidentin und Ex-UN-Botschafterin Rosa Otunbajewa sowie Premierminister Almas Atambajew von der Sozialdemokratischen Partei.
Dem Parlament stehen große Aufgaben bevor: Stabilität und Transparenz, Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption. Auch das wirtschaftliche Gefälle zwischen dem Norden und dem Süden des Landes ist ein großes Problem. Eine der Einnahmequellen, um die gerade gestritten wird, ist die Versorgung der NATO-Truppen für Afghanistan mit Treibstoff. Sowohl Russland als auch die USA unterhalten Militärbasen auf kirgisischem Boden und ringen um geopolitischen Einfluss. So versuchen russische Unternehmen wie Gazprom in das Treibstoffgeschäft einzusteigen, argumentieren mit Korruptionsbekämpfung. Bisher kontrollierte Maxim Bakijew, der Sohn des gestürzten Präsidenten, die Lieferungen – mit zweifelhaften Besitzansprüchen. Die neue Regierung beabsichtige, die Öllieferungen vorerst in staatlicher Hand zu behalten, meldet das Nachrichtenportal Eurasianet.
Meike Kloiber ist Ingenieurin und Journalistin und lebt in Hannover. Sie arbeitet zu den Schwerpunkten Entwicklungspolitik und Reisen.






